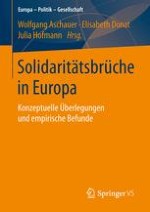2016 | OriginalPaper | Chapter
11. Abstiegsangst und Tritt nach unten? Die Verbreitung von Vorurteilen und die Rolle sozialer Unsicherheit bei der Entstehung dieser am Beispiel Österreichs
Author : Mag. Julia Hofmann
Published in: Solidaritätsbrüche in Europa
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.
Select sections of text to find matching patents with Artificial Intelligence. powered by
Select sections of text to find additional relevant content using AI-assisted search. powered by