Open Access 2024 | Open Access | Buch
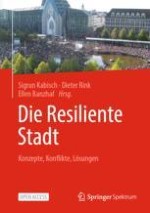
Die Resiliente Stadt
Konzepte, Konflikte, Lösungen
herausgegeben von: Sigrun Kabisch, Dieter Rink, Ellen Banzhaf
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Open Access 2024 | Open Access | Buch
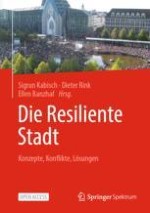
herausgegeben von: Sigrun Kabisch, Dieter Rink, Ellen Banzhaf
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Resilienz ist das Konzept der Stunde. Die Coronakrise, die Flutkatastrophe im Ahrtal und die Energieknappheit haben Resilienz an die Spitze der politischen Agenda gesetzt. Auch für die Stadtentwicklung gilt Resilienz als Ziel. Doch was steckt hinter diesem relativ neuen Begriff?
In diesem Open-Access Band erfahren die Leser*innen wie Städte auf Krisen und Katastrophen besser vorbereitet werden müssen, um diese gut zu überstehen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Die Beiträge zeigen konkrete Beispiele, wie Städte resilienter gestaltet werden können.
Welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden und welche Hindernisse gibt es? Für das Ziel urbaner Resilienz bedarf es rascher, tiefgreifender und systemischer Wandlungen auf allen Ebenen, von der Gesamtstadt bis zum Quartier oder der Nachbarschaft. Der Weg dahin und die entsprechenden Instrumente sind vielfach bekannt; dennoch wird bislang nicht mit der notwendigen Entschlossenheit vorgegangen.
Dieser Band enthält empirisch belegte Beispiele aus der aktuellen Stadtforschung, zeigt Konflikte auf und diskutiert Lösungen. Die Beiträge analysieren, wie bestehende Einsichten zum Handeln führen und vorhandenes Wissen klug eingesetzt werden kann. Sie verweisen auch darauf, warum existierende Lösungsvorschläge nicht zum Einsatz kommen. Anhand der Betrachtung unterschiedlicher kommunaler Handlungsfelder wie blau-grüner Infrastrukturen, Energie- und Wärmewende, Umweltstressoren, Wohnen und Gesundheit wird ein tieferes Verständnis für die resiliente Stadt entwickelt.
Das Werk richtet sich an Stadt- und Regionalplaner*innen, Geograph*innen, Stadtforscher*innen und Umweltwissenschaftler*innen sowie an Verantwortliche in Kommunalpolitik und -verwaltung.