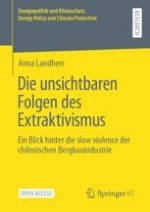Temblará el grito contenido de la tierra.
2.4.1 Bergbau in Lateinamerika und seine Konflikte heute
Der Bergbau spielt seit Anfang des kapitalistischen Weltsystems bis heute eine zentrale Rolle im kapitalistischen Weltsystem. Wie oben dargestellt (siehe Abschnitt
2.2.4), waren es besonders die Bodenschätze, die die „Eroberung“ der „neuen Welt“ vorangetrieben haben (Machado 2014). Seitdem sind sie wesentlicher Bestandteil des modernen kapitalistischen Industriesystems, der Infrastrukturen der Wohlstandsgesellschaften sowie der Technologien der Zentren (Altvater 1992:23 ff.). Es geht dabei um weit mehr als die Nachfrage nach Edelmetallen. Im Folgenden werde ich einen kurzen Überblick über die Bedeutung des Bergbaus geben, um daraufhin auf seine allgemeinen sozial-ökologischen Konsequenzen einzugehen. Im Gegensatz zu den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels gehen die folgenden Abschnitte nicht nur auf die bestehende Theorie, sondern auch ganz konkret auf den Forschungsgegenstand selbst ein. In Kapitel
5 wird dieser nochmals kontextualisiert und auf den konkreten Fall bezogen dargestellt. Aufgrund der Spezifität des Forschungsthemas erscheint es mit allerdings unabdinglich diesen schon vor der Fragestellung und Heuristik (Kapitel
3) einzuführen, um es dem/der LerserIn zu ermöglichen, die spezifischen Merkmale, die ihn zu einem prädestinierten
slow violence-Phänomen machen, nachvollziehen zu können.
Bergbauprodukte sind überall: Gold und Silber, aber viel mehr noch Kupfer und Eisen (und der daraus hergestellte Stahlt) werden in der Automobil- und Transportindustrie genauso großzügig eingesetzt wie in der Bauindustrie und in der Errichtung moderner Infrastruktur. Kupfer ist zentral für Elektroinstallationen, für Strom- und Netzkabel und -trassen, Rohrleitungen, elektrische Maschinen und Elektromotoren, beim Schienenverkehr und generell für den Gebäudebau. Stahl und Eisen wiederum werden sowohl in der Bauindustrie (besonders im Hochbau), als auch im Schiffsbau und besonders in der Herstellung eines Großteils von Maschinen (darunter auch Autos, landwirtschaftliche Maschinen, Kräne, Pumpen, Förderanlagen, Turbinen) aber auch im Brückenbau, für die Herstellung von Waffen und Werkzeugen sowie Stahlseilen benötigt. Des Weiteren waren Bergbauprodukte wie Salpeter als Düngemittel ein Grundstein für großflächige industrielle Landwirtschaft. Mineralien und Seltene Erden werden in der Chemieindustrie, bei der Herstellung von Glas, Keramik, Katalysatoren und Elektronik sowie in der Metallurgie benötigt. Besonders bei Lithium, Kobalt und Nickel gibt es derzeit eine große Nachfrage für die Herstellung von Batterien im Bereich der Elektroautos und erneuerbarer Energien. Der Abbau der benötigten Rohstoffe für die sogenannte grünen Technologien, also die „kritischen“ und „strategischen“ Rohstoffe der heutigen Zeit wird durch die steigende Nachfrage auf dem Weltmarkt derzeit stark intensiviert und führt in den extraktivistischen Ländern (aus denen sie stammen) seit geraumer Zeit zu einer stetigen Intensivierung des Bergbaus (Alimonda 2011; Martínez-Alier & Walter 2015; Svampa 2016). Nicht nur Lateinamerika, sondern auch ostasiatische Staaten und andere Semi-Peripherien des Weltsystems nehmen im Bereich der Bergbauprodukte eine wichtige Rolle ein (Arboleda 2020; Rodríguez 2020).
Der Rohstoffboom ab Anfang des 21. Jahrhunderts hatte in Lateinamerika allerdings besonders starke Konsequenzen. Der Anteil der Bergbauprodukte in den Materialflüssen der Region ist von zehn Prozent im Jahr 1970 auf 25 Prozent im Jahr 2009 gestiegen. Im selben Jahr stellten Bergbauprodukte mit 2100 Millionen Tonnen materiell gesehen den zweithöchsten Export an Materie nach dem an Biomasse dar (West & Schandl 2013). Die Region produzierte fast die Hälfte des weltweit extrahierten Kupfers, sowie die Hälfte des Silbers und über 20 Prozent des globalen Zinks und Goldes (Henríquez 2012). Ein Drittel der Bergbauinvestitionen fließt auf diese Weise nach Lateinamerika (Ericsson & Larsson 2013). Ein Großteil des Kupfers, rund dreißig Prozent der gesamten Produktion, wird allein in Chile extrahiert (Dorner 2020: 6). Neun Prozent des weltweiten Kupferabbaus entfallen allein auf den staatlichen chilenischen Konzern Codelco.
43 Kupfer stellt gerade vor dem Hintergrund der Energiewende einen Rohstoff mit zentraler Bedeutung für die Zentrums-Länder dar (Dorner 2020: 6).
44 Unter besonderem Druck stehen derzeit Bolivien, Argentinien und Chile zudem deshalb, weil auf ihren Territorien 70 Prozent der hochbegehrten Lithiumvorkommen liegen. Chile allein exportiert derzeit fast 60 Prozent des weltweiten Lithiums.
45
Die sozialen und ökologischen Kosten (siehe nächster Abschnitt) steigen mit zunehmendem Druck auf die Vorkommen nicht proportional, sondern exponentiell. Hinzu kommt, dass der Bergbau ein „intrinsisch nicht-nachhaltiger“ Sektor ist (Landherr 2018: 131 ff.). Bergbauressourcen sind per se nicht erneuerbar und somit begrenzt, ihre Extraktion und Weiterverarbeitung ist grundsätzlich nicht gänzlich nachhaltig gestaltbar und geht deswegen mit erheblichen Kosten für die Umwelt und die Menschen an den unterschiedlichen Stationen der Wertschöpfungskette einher (Martínez-Alier & Walter 2015:87 ff.). Dabei fällt die große Mehrheit dieser Kosten im Falle des Bergbaus direkt am Abbauort an. Die Umweltbelastung und die damit einhergehenden ökologischen Auswirkungen können teilweise zwar leicht minimiert, aber keinesfalls gänzlich behoben werden (Bridge 2004). Die Industrie ist zudem stark abhängig von anderen Ressourcen wie Wasser, großen Mengen an Energie und dem Einsatz von chemischen Komponenten. Deren Einsatz kann durch neue Technologien nur teilweise minimiert werden. Besonders aber die Abfall- und Tailingsproduktion nimmt stetig weiter zu (siehe nächster Abschnitt) und stellt ein grundlegendes und größtenteils irreversibles
46 Problem für Mensch und Natur dar (Martínez-Alier & Walter 2015). Peak metals/minerals (Kerr 2014) sollten demnach nicht am reinen Vorkommen der Metalle, sondern neben den abnehmenden ökonomischen Gewinnen vor allem an den steigenden sozialen und ökologischen Kosten und daraus resultierenden Grenzen gemessen werden (Prior et al. 2012).
Die ökologischen Auswirkungen auf Wasser, Böden, Gesundheit, Lebensformen und deren gesellschaftlichen Rechte (Berechtigung) versetzt UmweltaktivistInnen und besonders betroffene Bevölkerungsgruppe zunehmen in Sorge. Es ist daher nicht verwunderlich, dass in diesem Sektor auch besonders viele sozial-ökologische Konflikte auftreten (siehe bspw. für Chile INDH 2016). Die Konflikte können an den unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfungskette entstehen. Typischerweise treten sie an vier Momenten auf: bei der Extraktion, beim Transport, bei der Weiterverarbeitung und bei der Entsorgung der Abfälle des Produktionsprozesses (Martínez-Alier & Walter 2015: 94; Arboleda 2020). Im Fall vom Bergbau fällt der Extraktionsort in der Regel mit dem ersten Verarbeitungsort, den zentralen Materialtransportwegen und dem Lagerungsort der größten Menge der produzierten Industrieabfälle zusammen. Es kommt in diesem Kontext vor, dass sogenannte „Opferzonen“ (
zonas de sacrificio) entstehen, das heißt, geografische Räume, die äußerst hohe Maße an Umweltbelastungen konzentrieren. In diesen Zonen nehmen häufig einzelne Industrien große Mengen an Ressourcen und Senken in Anspruch und geben Schadstoffe über verschiedene Wege (Luft, Wasser, Böden) an die Umwelt ab. Die Folge ist nicht zuletzt eine stetig steigende Zahl an Konflikten. Die Daten von OCMAL
47 zeigen, dass bezüglich des Bergbaus die Länder Peru, Mexiko und Chile dabei an der Spitze der Liste stehen. Von den 284 von OCMAL aufgelisteten Bergbaukonflikten in Lateinamerika befinden sich 49 allein in Chile.
48 Laut EJOLT sind diese zu 50 Prozent indigenen Gruppen zuzuordnen (Martínez-Alier & Walter 2015). Bei 162 (mehr als die Hälfte) davon handelt es sich um Konflikte zwischen Unternehmen und Bevölkerung, die um die Nutzung des Wassers geführt werden. Dabei fällt im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf, dass nur einer der drei empirischen Untersuchungsfälle derzeit in einer der existierenden Datenbanken gelistet ist. Tailings sind nur in seltenen Fällen Ausgangspunkt oder zentrales Thema eines offenen Konflikts. Selbst wenn ein Konflikt im Kontext von Tailings entsteht, werden sie höchstens im Laufe eines solchen offenen Konflikts überhaupt auf die Liste der Konsequenzen des Bergbaus aufgenommen oder als Ursache für andere Probleme – wie etwa die Wasserverschmutzung – wahrgenommen. Tailings als alleinstehendes ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem, werden in den seltensten Fällen durch einen sozial-ökologischen Konflikt sichtbar.
Die Omnipräsenz der Bergbauprodukte in der kapitalistischen Produktion und somit im gesamten modernen Wirtschaftssystem sowie die zahlreichen daraus resultierenden sozial-ökologischen Konflikte auf der ganzen Welt spiegeln sich thematisch auch in den Sozialwissenschaften und insbesondere in der Politischen Ökologie und der Extraktivismusdebatte wider, was den Bergbau und dessen Konflikte zu einem gut erforschten Forschungsgegenstand macht. Hierzu zählen Klassiker wie „We eat the Mines and the Mines eat us“ von June Nash (1983), Forschungen zur Bergbaukonflikten in unterschiedlichen Weltregionen (Dietz & Engels 2017; Dietz 2019; Bebbington 2007; Romero-Toledo 2019) und den daraus resultierenden Ungleichheiten (Göbel & Ulloa 2014) oder die unzähligen Sammelbände zum Thema (Alimonda 2011; Delgado Ramos 2010) sowie die globalen Analysen der neuen Ressourcenabbaupolitik (Machado 2014, 2015) und rekonfigurierten Territorialitäten (Svampa 2020), die mit dem Aufstieg semi-peripherer ostasiatischer Staaten im Weltsystem und einer durch logistische Netzwerke reorganisierte Bergbauindustrie einhergehen, wie sie Martín Arboleda (2020) in „Planetary Mine. Territories of Extraction under Late Capitalism“ beschreibt. Auch in der Ungleichheitsforschung – spezifisch in der zu Environmental Justice – wird die Bergbauindustrie in vielen Fällen als Ursache für die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheiten identifiziert (Göbel 2015; Alfie Cohen 2015; Martínez-Alier und Roca-Jusmet 2001; Martínez-Alier 2002, 2004a). Studien zum environmentalism of the poor (Martinez-Alier 2002; Folchi 2001) und dem so genannten empty belly ecologism widmen sich ebenfalls häufig diesem Bereich.
In der Folge sind sozial-ökologische Konflikte sowie die beteiligten Akteure in ihnen, die Macht- und Herrschaftsbeziehungen sowohl auf lokaler Ebene (Bechtum 2022; Nacif 2019; Svampa 2020:78 ff.), auf nationaler Ebene (Valencia-Hernández et al. 2017; Svampa 2020; Landherr 2018; Landherr et al. 2019) als auch auf globaler Ebene (Arboleda 2020; Fischer et al. 2016) und entlang des gesamten Produktionsprozesses und den daraus resultierenden Wertschöpfungsketten (Fischer et al. 2010; Fischer et al. 2021) und Stoffströmen (Martínez-Alier & Walter 2015; Schaffartzik & Kusche 2020) umfangreich beforscht worden. Diese Literatur ist außerordentlich wertvoll für die vorliegende Arbeit und ermöglicht es, auf bestehende Forschungsergebnisse und Erklärungsansätze zu diesem Thema zurückzugreifen. Sie stellt darüber hinaus einen guten Ausgangspunkt dar, um das Thema dieses Vorhabens innerhalb des lokalen, nationalen und globalen Kontextes einzubetten und bei der Aufarbeitung und Analyse der erhobenen Daten ein umfangreicheres Gesamtbild des Umgangs mit den industriellen Abfällen des chilenischen Bergbaus darstellen zu können. Diese aufgeführten Untersuchungen sind unter anderem sehr aufschlussreich, um diejenigen Ungleichheiten auszumachen, mit denen sich die slow violence im Bergbau überlappt. Die bisherige Forschung weist allerdings diesbezüglich auch eine deutliche Forschungslücke auf, die im Mittelpunkt des Forschungsinteresses dieser Arbeit stehen wird. Die aufgeführten Arbeiten beschäftigen sich fast ausschließlich mit gesellschaftlichen Umweltproblemen und Fällen der sozio-ökologischen Ungleichheit, die bereits durch einen manifesten Konflikt sichtbar geworden sind. Das bedeutet, dass slow violence-Phänomene wegen den ihnen inhärenten Merkmalen hier so gut wie kaum erfasst werden. Auch das Thema der Tailings an sich wird entweder nur als eines unter vielen Risikos aufgelistet und nicht weiter ausgeführt, oder aber nur dann erwähnt, wenn die von ihnen hervorgerufenen sozial-ökologischen Probleme durch ein katastrophales Ereignis plötzlich sichtbar werden. Damit weist die bisherige Forschung mit Blick auf die latenten und unsichtbaren Ungleichheiten eine Lücke auf.
Allerdings finden sich auch unter der bestehenden Literatur Ausnahmen, die sich mit Phänomenen der slow violence im Bergbausektor beschäftigten. So widmet sich etwa Horacio Machado Aráoz (2011) seit einiger Zeit den biopolitischen Konsequenzen dieser Industrie und seiner Industrieabfälle und darunter auch der „materiellen Gewalt“, die auf die Körper und Territorien ausgeübt wird sowie der „symbolischen Gewalt“ der öffentlichen Einrichtungen, der Gesundheitsämter und des Rechtswesens, die diese materielle Gewalt nicht anerkennen oder minimieren (Machado 2011: 137 f.). Dabei liefert er eine detaillierte Beschreibung der slow violence, die von den Produktionsprozessen im Bergbau ausgeht und legt dar, wie diese „ihre irreversiblen Spuren auf Körper und Territorien“ hinterlassen (ebd.: 137). Er beschreibt die gesundheitlichen Folgen der hohen Konzentrationen an toxischen Substanzen im Blut der Kinder und Erwachsenen, die Haut- und Atemwegskrankheiten, die neurologischen Anomalien und Erkrankungen des Verdauungstrakts, die hohen Krebs-, Morbiditäts- und Mortalitätsraten in der benachbarten Bevölkerung solcher Bergbauprojekte. Die lokale Bevölkerung – das wird in Machados Forschung deutlich – lebt in einer vergifteten Umwelt, einem verstümmelten Ökosystem, mit hoher Luftverschmutzung, stark belasteten Gewässern und Böden sowie kranken Pflanzen und Tieren. Er beschreibt auch die sich immer weiter zuspitzende Armut, die die frühe Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit zusammen mit der Vernichtung lokaler Ökonomien und den Bedingungen für eine erfolgreiche Subsistenzwirtschaft zur Folge haben (ebd.: 137 ff.). In meiner vorliegenden Arbeit werde ich an derartige deskriptive Forschungen anschließen und darüber hinaus darlegen, warum diese dramatischen Probleme und die Situation der „Gewalt über Körper und Territorien“ gesellschaftlich meist nicht sichtbar werden und die damit einhergehenden Konflikte meist latent bleiben. Dafür ist es zunächst nötig, nach den spezifischen Charakteristika der Schadstoffe, Chemikalien und Schwermetallen im Bereich des Bergbaumülls und deren Einfluss auf die wissenschaftliche und gesellschaftliche Unsichtbarkeit der mit ihnen einhergehenden sozial-ökologischen Problematik zu fragen.
2.4.2 Altlasten, chemische Substanzen und Tailings: die schleichende und unsichtbare Gefahr des Bergbaus
Die Wertschöpfungskette von Metallen und Mineralien zeichnet sich dadurch aus, dass der ökonomische Reichtum, der am Ort der Extraktion und der Aufbereitung der Erze verbleibt, äußerst gering ist, dabei aber enorme ökologische und soziale Kosten entstehen.
49 Diese Kosten steigen, wenn die Reinheit der Vorkommen und somit die Konzentration der Mineralien und Metalle in den Erzen über die Zeit abnimmt und deshalb für den gleichen Ertrag insgesamt mehr Material gefördert werden muss. Dabei steigt auch ihr Energie- und Wasserverbrauch, die Menge an eingesetzten Chemikalien und die Produktion von Abgasen, Schlacke, Abfällen und Tailings (Kerr 2014). Während die Industrie diesbezüglich derzeit stark darum bemüht ist, die öffentliche Wahrnehmung über Bergbau zu verändern, indem sie in neue Technologien investiert und Konzepte wie
Green Mining in den Mittelpunkt stellt, führt die steigende Nachfrage zusammen mit dem abnehmenden Reinheitsgrad zu einem weiterhin stetig steigenden Ressourcen- und Energieverbrauch und einer stetig zunehmenden Umweltbelastung durch immer größere Mengen an Tailings. Dieser Teufelskreis aus steigender Nachfrage und sinkender Reinheit ist mit Blick auf die Endlichkeit der Ressourcen der intrinsischen Nicht-Nachhaltigkeit der Bergbaus selbst geschuldet (Landherr 2018:132 f.). Darüber hinaus werden heutzutage vermehrt neue Vorkommen erschlossen, die aufgrund ihres geringeren Reinheitsgrades vorher nicht rentabel erschienen (Giurco et al. 2010). Die vom Bergbau ausgehende Umweltbelastung wird umso problematischer, weil sich durch den Druck des Weltmarkts die
frontiers des Bergbaus in sensible Ökosysteme (etwa tropische Regenwälder, Nebelwälder, Gletscher, usw.) ausbreiten und auf Territorien indigener oder kleinbäuerlicher Bevölkerungsgruppen stoßen. Gerade in solchen Gebieten nehmen die Investitionen zuletzt allerdings stark zu (Svampa 2020; Bridge 2004; Bebbington 2012b).
Die größten ökologischen Belastungen im Bergbau entstehen – wie schon dargestellt – am Ort der Extraktion. Die Umweltverschmutzung resultiert meistens durch das Freisetzen chemischer Substanzen und Reagenzien während des Extraktions- und Verarbeitungsprozesses sowie im Lagerungsprozess der Abfälle. Die für diese Arbeit zentralen Rückstände des Bergbaus sind die dabei entstehenden Tailings, die ein Abfallprodukt des Bergbaus darstellen, das in großen Mengen bei der Aufarbeitung der Erze produziert wird. Die Art der Tailings, ihr Volumen und die Zusammensetzung der in ihnen enthaltenen Chemikalien und Schwermetalle hängen wiederum direkt vom Typus der Metalle und Mineralien ab, die abgebaut werden. Während bspw. Eisen oder Aluminium in relativ hohen Konzentrationen im Untergrund vorzufinden sind, müssen für Metalle wie Silber oder Kupfer sehr große Mengen an Erzen aufbereitet werden, was wiederum zu hohen Mengen an Tailings führt. Bei Kupfer stellt sich das Verhältnis als eins zu hundert dar (für ein Kilo Kupfer muss etwa. 1 Tonne Material bearbeitet werden) (Schoer et al. 2012; Martínez-Alier & Walter 2015: 89). Besonders dramatisch sind die Zahlen bei der Produktion von Gold: aus einer Tonne Erz werden lediglich 20 Gramm Gold gewonnen (Schoer et al 2012; Martínez-Alier & Walter 2015: 89). Die stetig steigende Bergbauproduktion und gleichzeitige „Verschlechterung“ der Vorkommen führt – wie schon erwähnt – weltweit zu einem starken Anstieg an jährlich neu produzierten Tailings und Industrieabfällen im Bergbausektor (Giurco et al. 2010; Mudd 2007a; Prior et al. 2012).
Die feinkörnigen Rückstände enthalten je nach Mineralien oder Metallen, die aus dem Erz extrahiert werden, unterschiedliche Chemikalien und Substanzen, die den Erzen – je nach Zusammensetzung der Erze – in unterschiedlichen Mengen und Kombinationen zur Trennung der Metalle von den übrigen Materialien beigefügt werden. Typischerweise handelt es sich dabei um hoch giftige Stoffe, wie Schwefelsäure in der Kupferproduktion
50 oder Quecksilber in der Aufarbeitung von Gold sowie Zyanid im Gold- und Silberabbau (Español 2012).
51 Die Erze enthalten außerdem an sich schon eine große Menge an Schwermetallen, die auf natürliche Weise im Untergrund vorkommen und durch den Produktions- und Lagerungsprozess extrahiert und an die Umwelt freigegeben werden. Die häufigsten gesundheits- und umweltschädlichen Substanzen, die in Tailings in hohen Konzentrationen vorzufinden sind, sind neben den oben genannten zudem Arsen, Blei, Chrom, Kupfer und Zink
52(Sernageomin 2018). Nach der Extraktion stellen diese Substanzen vor allem in ihrer Kombination eine ernstzunehmende Gefährdung für die Gesundheit der Menschen und die Ökosysteme dar und können auch bei ordnungsgemäßer Lagerung nach internationalen Standards (meist in halbflüssiger Form in Absatzbecken oder Schlammteichen) mit einer hohen Umweltbelastung verbunden sein (Engelke & Klug 2018). Immer wieder versickert beispielsweise belastete Flüssigkeit in den Boden oder es geraten Schwermetalle und Chemikalien durch Wind, Regen und andere Wetterphänomene in die Umwelt. Auf diese Weise gelangen Schadstoffe auch in die Nahrungskette, die Ökosysteme und die Körper von Tieren und Menschen.
Auch durch die Oxidierung der Metalle und Mineralien (bspw. Nickel, Kupfer oder Blei), die in den Erzen natürlich vorkommen und die auftritt, sobald diese in Kontakt mit Sauerstoff, Wasser oder bestimmten Bakterien kommen, entstehen giftige Substanzen wie Schwefelsäure (Sernageomin 2018). Dies geschieht sowohl im Produktionsprozess als auch bei der darauffolgenden Lagerung. Die giftigen Substanzen dringen, besonders im Tagebau durch die höhere Wetterexposition, in die Böden und das Grundwasser oder oberflächliche Gewässer ein und breiten sich auf diese Weise unkontrolliert in andere Gebiete aus. Durch diese Prozesse können auch die in den Erzen enthaltenen Schwermetalle in das Grundwasser gelangen (Martínez-Alier & Walter 2015: 90; Bridge 2004; Giurco et al. 2010; Machado 2010).
Gelagert werden Tailings meistens in großen Auffang-, Absatzbecken oder Schlammteichen in Form von Schlamm (Engelke & Klug 2018). Die Dauer der Schadstoffbelastung, die von dieser Tailingdeponien ausgeht, kann von mehreren tausend Jahren bis mehrere hunderttausend Jahre betragen (Sernageomin 2018; Weinberg 2010; Terram 2003; Umweltbundesamt 2004), wie auch ExpertInnen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) betonen (PW03). Theoretisch müssen sie deshalb auch über diese Zeiträume gewartet und instandgehalten werden, um die Ausbreitung der Schadstoffe auf die Umgebung zu vermeiden und die chemische Stabilität in ihnen zu erhalten (Sernageomin 2018). Um eine flüssige Konsistenz beizubehalten, braucht die Lagerung der Tailings ausreichend Wasser. Bisher gibt es auch keine endgültigen Lösungen, um über lange Zeiträume das Versickern von Bestandteilen in den Untergrund und das Grundwasser zu verhindern (Umweltbundesamt 2004: 329 ff.). Über diese Zeiträume muss also nicht nur für ihre chemische Stabilität, sondern auch für die physische Stabilität der Tailingdämme und Auffangbecken gesorgt werden (ebd.: 327 ff.). Immer wieder kommt es allerdings sogar bei noch funktionierenden Deponien zu Dammbrüchen mit katastrophalen Folgen. Bei fehlender Wartung der „sicher geschlossenen“ Bergwerke und der Einordnung der Tailings als Altlasten wird dies umso häufiger passieren. Statt ein sicheres Endlager stellen Tailingdämme folglich ein über sehr lange Zeiträume beständig drohendes und über die Zeit wachsendes Risiko für die naheliegende Bevölkerung und die Umwelt dar (Adasme et al. 2010). Dies gilt auch für die historischen Tailings, die in der Regel nicht als Schlamm, sondern in trockener Form gelagert werden.
53 Dabei ist die Ausbreitung über die Luft und die Oxidierung ihrer Komponenten unvermeidbar. Ausschlaggebend für die Stärke und Art der Umweltverseuchung ist nicht unbedingt der Gesamtumfang der Tailings oder die Größe der Deponie, sondern ihre chemische Zusammensetzung. Es gibt also auch sehr kleine Deponien, die ein hohes Risiko für Umwelt und Gesundheit darstellen. Auch Projekte der Aufbereitung von Tailings tragen häufig zu noch größerer Belastung bei.
54 Im Fall von Tailings gibt es zudem keine „endgültige Lösung“, sie können nur „sicher verpackt“ werden, aber ähnlich wie Atommüll nicht beseitigt werden. Sie stellen damit ein dauerhaftes gesellschaftliches Problem dar von dem ein konstantes Risiko ausgeht (Lottermoser 2007).
Tailings wurden zudem historisch in der Regel nicht ordnungsgemäß gelagert,
55 weshalb sie sich heute ungesichert in großen Mengen und mit hohen Schadstoffkonzentrationen in ehemaligen (und teils aktuellen) Bergbaugebieten wiederfinden (Sernageomin 2020). Diese historischen Tailings liegen dann nicht in abgetrennten Becken, sondern als Deponien mit feinkörnigem sandartigem Material vor. Dieses Material unterscheidet sich in den meisten Bergbaugebieten kaum von der Umgebung, da es farblich den vor Ort vorkommenden Böden gleicht. Durch diese
materielle Unsichtbarkeit und das
kollektive Vergessen ihrer Existenz (viele von ihnen sind mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte alt) werden sie häufig nicht einmal als solche wahrgenommen, sind folglich auch nicht als solche gekennzeichnet und können sich deshalb ungestört ausbreiten (siehe hierzu Kapitel
6). Dies ist ein zusätzlicher Grund dafür, warum die Anzahl der Tailings konstant steigt, da alte Tailings wiederentdeckt werden. In Chile wurden bspw. im Jahr 2016 606 Tailingdeponien gezählt, im Jahr 2020 steht die Zählung schon bei derzeit 758 bekannten Tailings.
56 Im Jahr 2016 wurden die Tailings zudem kategorisiert. Damals galten nur 100 als „aktive“ Tailings, was bedeutet, dass sie einem noch funktionierenden Bergwerk zugehörig sind. Die historischen Tailings geschlossener Bergwerke beliefen sich auf 266 und 239 galten als verlassen bzw. konnten ihren Verursachern nicht zugeordnet werden. Die allermeisten von ihnen, besonders die der letzten zwei Kategorien sind – nach heutiger Rechtslage
57– nicht ordnungsgemäß gesichert. ExpertInnen gehen zudem von einer sehr hohen Dunkelziffer aus und schätzen die noch nicht registrierten, „verlassenen“ Tailings auf mehrere Tausend (siehe Kapitel
5 und PW03, PW05). Außerdem kommen durch die aktiven Bergwerke in Chile jährlich 700 bis 800 Millionen Tonnen Tailings hinzu (Sernageomin 2015).
Trotz des enormen Ausmaßes des Bergbaumülls, der unschätzbar langen Zeit ihrer Folgebelastungen und ihrer schon heute großen sozial-ökologischen Folgen, sind Tailings- nicht einmal in den sogenannten Bergbaunationen wie Chile ein bekanntes oder gesellschaftlich als relevant anerkanntes Umweltproblem. Die öffentliche Wahrnehmung erreichen Tailings auch weltweit nur selten. Dies ist meist nur dann der Fall, wenn ein spektakulärer oder katastrophaler Unfall – etwa in Form von Dammbrüchen wie sie 2015 und 2019 in Brasilien eintreten sind – geschieht. Sie werden dann allerdings als einmalige Ereignisse, als Unglück oder Folge fahrlässiger Instandhaltung eingeordnet und nicht mit einer permanenten
slow violence in Verbindung gebracht, die über lange Zeiträume von ihnen ausgeht. Auch in Chile wurde erst dann erstmalig in der Öffentlichkeit über Tailings gesprochen, als beim Erdbeben 2010 ein Damm brach und ein Dokumentarfilm „Minas de oro, desechos de muerte“
58 von Carola Fuentes diesen Fall kurzzeitig zum öffentlichen Thema machte. Die dennoch derzeit bestehende allgemeine gesellschaftliche Unsichtbarkeit der Tailings schlägt sich auch in der zu ihnen bestehenden sozialwissenschaftlichen Forschung nieder. Im Folgenden wird kurz auf die bestehende Literatur zu ähnlichen ökologischen
slow violence-Phänomenen, die durch materiell unsichtbare Schadstoffe ausgelöst werden, sowie auf die vereinzelten Forschungen zu Tailings in Chile eingegangen.
2.4.3 Materiell unsichtbare Umweltprobleme (und Tailings) in den Sozialwissenschaften
Die Auffassung des langsamen und schleichenden Charakters von Umweltphänomenen und der
slow violence, die von ihnen ausgeht, wurde von Rob Nixon (2011) nicht zuletzt von Rachel Carson übernommen, die als eine der ersten mit ihren Schriften über die langfristigen Auswirkungen menschlichen Handelns auf Ökosysteme ein größeres Publikum erreichte. Mit ihrem erstmals 1962 erschienenen Buch „Silent Spring“ legte sie den Grundstein für die US-Amerikanische Umweltbewegung. In ihrem Werk beschreibt sie das langsame und weitgehend unbeachtete Verschwinden von Tier- und Pflanzenarten – im Besonderen von Vögeln – sowie der Beschädigung von ganzen Ökosystemen seit dem massiven landwirtschaftlichen Einsatz von Pestiziden auf den Feldern (in diesem Fall hauptsächlich das Insektizid Dichlordiphenyltrichlorethan, abgekürzt DDT) (Carson 2000). Da sie in ihrem Buch vor allem über die langfristigen Folgen des Pestizideinsatzes schreibt, handelt es sich hierbei um ein Paradebeispiel dessen, was Nixon (2011) fünfzig Jahre später als
slow violence bezeichnet und auf weitere Umweltkatastrophen angewendet hat. Carson hält den Einsatz von giftigen Chemikalien und deren Ausbreitung auf Wasser, Luft, Böden und Meere, für einen der alarmierendsten Angriffe auf die Umwelt, da diese Art der Umweltverschmutzung größtenteils irreversibel sei: „In this now universal contamination of the environment, chemicals are the sinister and little-recognized partners of radiation in changing the very nature of the world – the very nature of its life" (Carson 2000:23). Das Ausmaß der Verbreitung dieser Chemikalien beschreibt sie schon damals als quasi allgegenwärtig. Jeder Mensch würde in seinem Leben mit ihnen in Kontakt kommen und WissenschaftlerInnen würden keine Tiere mehr finden, in deren Körpern keine Rückstände dieser Chemikalien nachzuweisen seien: „For these chemicals are now stored in the bodies of the vast majority of human beings, regardless of age. They occur in the mother’s milk, and probably in the tissues of the unborn child“ (ebd.:31). Und weiter: „Chemicals sprayed on croplands or forests or gardens lie long in soil, entering into living organisms, passing from one to another in a chain of poisoning and death“ (ebd.:23). Sie spricht dabei auch schon von dem in dieser Arbeit verwendeten Konzept des Nicht-Wissens. Dabei verweist sie nicht allein auf das Nicht-Wissen unter den Betroffenen oder den AnwenderInnen dieser Pestizide,
59 sondern auch auf das wissenschaftliche Nicht-Wissen: „I content, […] that we have allowed these chemicals to be used with little or no advance investigation of their effect on soil, water, wildlife, and man himself. Future generations are unlikely to condone our lack of prudent concern for the integrity of the natural world that supports all life“ (Carson 2000:29).
Seit Carsons Buch werden Schadstoffe, Müll, Strahlungen und Emissionen immer stärker Teil sozialwissenschaftlicher Forschung, stellen allerdings vergleichsweise immer noch ein Randthema innerhalb dieser dar. Auf globaler und nationaler Ebene werden beispielsweise in den Materialflussanalysen auch die materiellen Outputs erfasst (siehe Abschnitt
2.3.3), also teilweise auch die Industrieabfälle des Bergbaus. Allerdings werden diese in ihrer bloßen Menge und ohne qualitative Unterschiede dargestellt. Diese Methoden ermöglichen es zwar, wichtige Informationen etwa bezüglich des CO
2-Ausstoßes auf verschiedenen Ebenen herzustellen und auch sonst „unsichtbare“ Schadstoffe zu quantifizieren (Martínez-Alier & Walter 2015). In ihnen kommen allerdings viele der tatsächlich verursachten Abfälle nicht vor, sie quantifizieren vor allem das, was gesellschaftlich sichtbar ist. Auch die qualitativen unterschiede der quantifizierten Outputs bspw. bezüglich ihrer Toxizität für Mensch und Natur oder die zeitliche Ausdehnung ihrer Folgen in die Zukunft werden nicht erfasst. Abfälle im Allgemeinen tauchen in der Literatur also oftmals auf, werden allerdings fast nie in ihrer Spezifität und ihren potenziellen Risiken analysiert, sondern vielmehr als Ursache und Beispiel ungleicher Verteilung der Outputs des (globalen) sozialen Metabolismus und der Nutzung natürlicher Senken (Laser & Schlitz 2019, 2021; Adeola 2011; de Carvalho Vallin & Gonzalves Dias 2019; Hafner & Zirkl 2019).
Obwohl also „toxische Gefahren“, „atomare Bedrohungen“ und „gefährliche Strahlungen“ in der politökologischen, ökofeministischen oder ökomarxistischen Literatur oft als Beispiele „hinterhältiger“ und katastrophaler Konsequenzen menschlichen Handelns gegenüber der Natur und (meist sehr armen) Bevölkerungsgruppen genutzt werden (Mies & Shiva 2016:95, 97, 103), bleibt die Spezifik häufig unsichtbarer Schadstoffe in der Regel auch hier außen vor. Es geht so gut wie immer um die wenigen, bereits sichtbar gewordenen slow violence-Phänomene und öffentlich bekannte Umweltskandale. Besonders die Schadstoffbelastung durch Tailings steht – trotz ihrer überbordenden Problematik – nur sehr selten im Mittelpunkt sozialwissenschaftlicher Untersuchungen (Ureta 2016b, 2022; Ojeda-Pereira & Campos-Medina 2021). Seitdem der Klimawandel zu einer globalen öffentlichen Sorge geworden ist, kam es in den Sozialwissenschaften zwar in letzter Zeit vermehrt zu Forschungen zu den Ursachen des Klimawandels und somit auch zu den ihn verursachenden Treibhausgasen – im Besonderen zu CO2- und Methanausstößen – (Malm 2016; Mitchell 2011; Wissen 2016) sowie vereinzelt auch zu Analysen zum Umgang mit Atommüll (Brunnergräber et al. 2012; Brunnergräber & Mez 2014). Alle weiteren Formen und Arten unsichtbarer Schadstoffe, Chemikalien, Schwermetalle und Strahlungen und ihrer Auswirkungen auf soziale Prozesse, bestimmte Personengruppen und die Gesellschaft im Allgemeinen bleiben innerhalb der Politischen Ökologie, der Umweltsoziologie und generell der Sozialforschung allerdings Randthemen Die bestehenden Untersuchungen zu derartigen Themen innerhalb der Sozialwissenschaften wurden fast ausschließlich im Bereich der Umweltgeschichte (Environmental History) und den Science an Technology Studies (STS) durchgeführt (siehe unten). Ausnahmen stellen die Arbeiten von Francis O. Adeola (2011) zu giftigem Industriemüll und ihren Auswirkungen auf nahegelegene Gemeinden sowie diejenigen von Auyero und Swistun (2007, 2008a, 2009), in denen sie den Zustand der konstanten Ungewissheit (toxische Ungewissheit) der betroffenen Bevölkerung über die Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen ihres giftigen Umfeldes beschreiben oder jene von Singer (2011) dar, der eine anthropologische Untersuchung von Betroffenen durchführt und eine toxische Frustration bei den Betroffenen aufgrund fehlender Handlungsmöglichkeiten konstatiert.
Um die Schadstoffbelastung durch Tailings besser begreifen zu können, ist es also notwendig auf die Forschungen zum gesellschaftlichen Umgang mit Abfällen und Schadstoffbelastungen durch Chemikalien und Schwermetalle zurückzugreifen, die in der Umweltgeschichte und der STS darüber durchgeführt wurden. Im Bereich der Umweltgeschichte sind in den letzten Jahrzehnten einige Forschungsprojekte und -plattformen zum Thema (Industrie-)Müll und giftiger Abfälle entstanden, die teilweise in direkter Tradition zu Rachel Carsons Werk stehen. Darunter findet sich auch das internationale Forschungsnetzwerk „Deadly Dreams“, das interdisziplinäre Projekt „Toxic Commons“ oder die an der LMU München angesiedelte DFG-Emmy Noether Research Group „Hazardous Travels: Ghost Acres and the Global Waste Economy“ am Rachel Carson Center for Environment and Society unter der Leitung von Simone Müller. Dabei wird der Akzent häufig auf die Entstehungsgeschichte von bestimmten (Industrie-)Abfällen und ihre Entsorgung gelegt. Simone Müller untersucht bspw., wie die Weltmeere seit Jahrhunderten als Auffangbecken für alles „Ungewollte“ der Gesellschaft dienen. Im Meer können bis heute Abfälle außerhalb der Sichtweite und der (Umwelt-)Regulierungen verkappt werden. Alle nicht-recycelbaren Externalitäten des Wirtschaftssystems, besonders der giftige Müll, wurden auf diese Weise entsorgt: „The ships’ tales were one of the industrial world’s most toxic by-products, such as PCBs or outdated chemical weapons from the wars in Korea and Vietnam, which were first dumped and later on burned at sea. In the end, these ghost ships transported toxic remnants of industrial production in the Global North along former colonial shipping routes to “disposal” sites in countries of the Global South“ (Müller 2016b:13).
60 Andere AutorInnen betonen, dass nicht nur ferne Weltmeere, sondern selbst der menschliche Körper als Senke für gefährlichen Müll dienen kann (Brown 2016:41 ff.).
61 Zu Tailings können im Rahmen der Geschichtswissenschaft etwa die Arbeiten von Angela Vergara (2011) zur geschichtlichen Entstehung der Verseuchung der Bucht von Chañaral hervorgehoben werden, die in Kapitel
8 detailliert dargestellt werden.
Der gesellschaftliche Umgang mit Schadstoffen und chemischen Substanzen wird allerdings besonders innerhalb der Sociology of Science and Technology bzw. der Science and Technology Studies (STS) sowie von Ansätzen wie der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), die von Bruno Latour (1996, 2005) geprägt sind, erforscht. Diese Theorieansätze reihen sich zwar nicht unmittelbar in die bisher aufgeführten Theorietraditionen ein, sie sind allerdings von besonderer Bedeutung, um die Relevanz des Wissens, des Prozesses der Wissensproduktion und -verbreitung über unsichtbare Schadstoffe begreifen zu können, da sie die Besonderheiten dieser Art von Umweltbelastungen und dem gesellschaftlichen Umgang mit diesen herausarbeiten. Für mein Vorhaben sind diese Ansätze zudem deshalb relevant, weil sie die Rolle des Wissens in
Schadstoffkontroversen untersuchen und die verbreitete Kausalität zwischen Wissen und
action, das heißt die Annahme, dass Wissen automatisch zu problembezogenem Handeln führt, kritisch hinterfragen (Bickerstaff and Walker 2001; Irwin, Simmons & Walker 1999). Gerade diese Thematik des Übergangs von Wissen zu Handeln stellt ein Kernelement meiner Forschungsfrage und -heuristik dar.
62 Die Annahme, dass Wissen von einem Problem unmittelbar zu problembezogenem Handeln führt, wird in dieser Arbeit kritisch hinterfragt und nach den Konditionen und Voraussetzungen für das (Nicht-)Eintreten problembezogenen Handelns geforscht. Dennoch wird konstatiert, dass das Wissen über Phänomene eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Wahrnehmung und Handlung bezüglich
slow violence darstellt.
63 Dies ist auch bei Tailings der Fall, die oftmals an den Orten, wo sie deponiert werden und sich die chemischen Substanzen verbreiten, bei der lokalen Bevölkerung völlig unbekannt sind. Außer den Unternehmen, die diese Tailings produzieren und in manchen Fällen dem Staat, besitzt – wie meine empirische Forschung zeigen wird – in der Regel niemand ausreichend Informationen über ihre Existenz oder Schadstoffzusammensetzung.
Diese Unsichtbarkeit der chemischen Stoffe, die die Bergbauindustrie hinterlässt, ist auch ihrer Materialität zuzuschreiben. Die Substanzen sind für Laien meistens nicht sichtbar oder spürbar und es bedarf einer hohen Dosis oder langen Zeiträumen, damit sich die Symptome bei Natur und Mensch erkennbar machen (Ureta et al. 2018; Vogel 2008). In Bergbauregionen wie dem Norden Chiles heben sie sich weder farblich noch von ihrer Konsistenz her von der restlichen Umgebung ab, weshalb sie meist nur durch (natur-)wissenschaftliche Verfahren ausgemacht werden können (Vergara 2011). Die dafür notwendigen Messungen erfolgen aber in der Regel nur dort, wo Schadstoffe auch vermutet werden. Das heißt, es bedarf eines gewissen Vorwissens oder Verdachts über deren Anwesenheit an einem bestimmten Ort, damit überhaupt eine Produktion von Wissen über sie eingeleitet werden kann (Frickel 2008). Erst eine solche Messung kann sie dann tatsächlich sichtbar und zu einem öffentlich verhandelten Thema bzw. einem politischen Problem für Staat, Betroffene, Medien, Konzerne und die Wissenschaft machen (Vogel 2008; Frickel, S. & Elliott, J. 2018).
Daher werden im Folgenden einige Erkenntnisse der angesprochenen Forschungen aus den Bereichen der STS und der Umweltgeschichte dargelegt, die für meine Forschungsheuristik und die Bearbeitung der Forschungsfrage relevant sind. In erster Linie lässt sich dabei konstatieren, dass (technisches) Wissen und die daraus resultierende Risikobestimmung bzw. der Risikofaktor einer bestimmten chemischen Substanz keinen „absoluten Charakter“ haben (Vogel 2008). Das bedeutet, dass es sich bei Risiken erstens um eine Wahrscheinlichkeitsangabe handelt, mit der ein gewisses Ereignis eintreten kann. Zweitens besteht über die Effekte chemischer Stoffe auf lebende Organismen auch innerhalb der Naturwissenschaften in der Regel ein hoher Grad an Ungewissheit und Nicht-Wissen (Wehling 2001, 2006, 2011). Sowohl ihre Langzeiteffekte als auch die Wechselwirkungen bei der Kombination verschiedener Chemikalien sowie die verschiedenen Ausbreitungsmechanismen auf Umwelt und Körper sind meist weitgehend unbekannt (Vogel 2008). Hinzu kommt, dass auch der Forschungsprozess selbst ein sozialer Prozess ist, der von Machtverhältnissen, Interessen, Annahmen und der Weltanschauung der beteiligten Akteure durchzogen ist (Latour 1987). Letzteres wird in den Ergebnissen meiner empirischen Forschung, insbesondere in Kapiteln
8 zum Fall Chañaral, sehr deutlich.
Die politische Regulierung von und der öffentliche Umgang mit Chemikalien kann gleichzeitig nur dann erfolgen, wenn eine mögliche Gefahr oder Risiko auch bekannt ist, bzw. das Wissen über die Notwendigkeit einer Regulation existiert (Latour 2004; Frickel & Elliott 2018). Wenn ein hohes Maß an Nicht-Wissen (Wehling 2001, 2011) im Spiel ist, sind Regulierungen relativ und entsprechen nicht dem Risiko, das sie vermindern sollten (Nash 2008). Identität, Umgang und Regulierung von Chemikalien entstehen demnach aus dem, was wir über sie wissen (Fisher 2014). In dieser Hinsicht identifizieren Roberts und Langston (2008) eine Situation allgemeiner Ungewissheit über Chemikalien und ihre Effekte auf Körper und Umwelt. Im Sinne von Wehling (2011) kann der Umgang mit ihnen deshalb auch als eine Form der Gouvernance des Nicht-Wissens beschrieben werden.
Ein weiterer Aspekt, der dazu beiträgt, dass Schadstoffe unerkannt bleiben, ist das
verlorene Wissen durch
kollektives Vergessen (siehe Kapitel
6). Der Verlust von Wissen über die Zeit stellt vor allem bei
relict industrial waste eine große gesellschaftliche Herausforderung dar (Frickel 2008). Dies kann in Chile daran erkannt werden, dass die
historischen Tailings oftmals nicht mehr aufzufinden sind, obwohl sie immer noch ein großes Risiko darstellen (Ureta 2022). Das liegt unter anderem auch daran, dass ein und dieselbe chemische Substanz je nach sozialem Kontext unterschiedlich definiert wird. In unterschiedlichen Situationen kann sie als wissenschaftliches Objekt, als ökonomisches Produktionskapital oder als Risikofaktor verstanden werden (Fisher 2014). Wenn sich eine Substanz in diesem Sinne am „falschen Ort“ befindet (Deammrich 2008), wird sie überhaupt nicht als Schadstoff erkannt, weil sie dort zum Beispiel als produktives Element industrieller Aktivitäten gilt. Wenn diese „produktiven Elemente“, dann in Form von (Industrie-)Abfällen entsorgt werden, müssen sie ihre Identität ändern, um als Schadstoffe identifiziert zu werden (ebd.; Frickel 2008). Dies ist bei den „historischen“ Tailings in Chile mehrheitlich nicht der Fall gewesen. Da im Moment ihrer Entstehung kein Wissen über ihre potenziellen Risiken bestand, wurden sie nicht dokumentiert und galten nach dem Produktionsprozess erneut als Teil der „Natur“. Substanzen ändern also je nach sozialem Kontext und über die Zeit hinweg ihre „Identität“.
64 Die Regulierung und der Umgang mit Chemikalien hängen damit laut der bestehenden Forschung stark von der zugeschriebenen Identität ab. Gleichzeitig wird diese Identität wiederum durch politische Regulierungen verändert, wenn bspw. Böden, Wasser, Luft ab einer bestimmten Schadstoffkonzentration als „kontaminiert“ oder aber als „unbedenklich“ deklariert wird (Frickel 2008; Nash 2008).
Das gesellschaftliche Verständnis von Chemikalien ist zudem durch einen spezifischen historischen und sozialen Kontext geprägt, von dem abhängt, was wir heute als Schadstoff verstehen, wie Wissen über diese Chemikalien produziert wird, wie sie reguliert werden und wie von den verschiedenen Akteuren mit ihnen umgegangen wird (Nash 2008). Wissenschaft ist darüber hinaus nicht immun gegenüber sozialen, politischen und ökonomischen Interessen und hängt stark von den vorhandenen Technologien, den Einstellungen des Wissenschaftlers und ihrer eigenen Vergangenheit ab (Kuhn 1976). Außerdem ist der Umgang mit diesem Wissen immer auch eine Form von Machtausübung (Foucault 1977), wobei vor allem das Verschweigen von „heiklen“ Informationen eine verbreitete Praktik darstellt (Allen 2008). Wissen ist durchdrungen von den bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen sowie von dem aus ihnen entspringendem hegemonialen Diskurs (siehe Abschnitte
2.2.5 und
2.3.1). So etwa auch von der – in Abschnitt
2.3.1 diskutierten – Vorstellung einer strengen Trennung von Mensch und Natur (Gudynas 2012; Acosta 2014), die mit Blick auf die Kreisläufe chemischer Substanzen von den Tatsachen konterkariert werden, da diese Stoffe immer wieder unbemerkt und ungehindert in die Körper der Menschen eindringen. Debatten über Chemikalien und den politischen Umgang mit ihnen sowie ihrer Regulierung sind in ihren Wurzeln Debatten über die Beziehung zwischen Körpern und ihrer Umwelt (Nash 2008).
Was die Untersuchung von Tailings anbelangt, konnten Iván Ojeda-Pereira und Fernando Campos-Medina (2021) zwischen 2010 und 2020 zwar einen Anstieg der Gesamtpublikationen konstatieren, dabei handelt es sich allerdings fast ausschließlich um naturwissenschaftliche Forschungen aus Ländern der Zentren bzw. der Semi-Peripherie, die sich dem Bergbau widmen (66,7 Prozent stammen allein aus Kanada und China). Die beiden Autoren konstatieren einerseits, dass ein sehr begrenzter Anteil der Forschungen zu Tailings in den Peripherien stattfindet und identifizieren andererseits eine große Forschungslücke zu diesem Thema innerhalb der Sozial- und Politikwissenschaften (Ojeda-Pereira & Campos-Medina 2021). In extraktivistischen Ländern des globalen Südens, die sich primär auf den Export von Bergbauprodukten konzentrieren und demnach überproportional von den potenziellen Risiken der Tailings betroffen sind, wie es etwa in Chile der Fall ist, wird kaum wissenschaftliches Wissen über diese produziert. Seit 2012 widmet sich Sebastián Ureta
65 als einer der ersten
66 und einzigen dem Thema der Tailings in Chile. Er tut dies aus der Perspektive der Science and Technology Studies. Seine Arbeiten werden in der vorliegenden Forschungsarbeit besonders berücksichtigt, da sie sich im selben Kontext (Land, Region, Ortschaften) mit denselben Themen (gesellschaftlicher Umgang mit Tailings und verseuchten Böden) befassen. Trotz meiner engen Zusammenarbeit mit Ureta seit 2013 sowie thematischen Überschneidungen, handelt es sich allerdings um gänzlich unterschiedliche Forschungsfragen und -ansätze. Ureta befasst sich hauptsächlich mit der staatlich outgesourcten Wissensproduktion über Tailings (Ureta 2020), dem Umgang von Unternehmen mit nicht lebenden „Entitäten“ (Ureta & Flores 2018), der Untersuchung von Aushandlungsprozessen über „die Wahrheit“ bezüglich sozial-ökologischer Risiken zwischen Unternehmen, Staat und Bevölkerung (Ureta & Contreras 2020) sowie der Entstehung von toxischen „Geosymbiosen“ zwischen der Natur, ihren BewohnerInnen und den Schadstoffen, die von Tailings ausgehen (Ureta & Flores 2022). Außerdem untersucht er im Sinne einer selbstkritischen Reflektion der eigenen wissenschaftlichen Arbeit die Art, wie Unternehmen von der Zusammenarbeit mit SozialwissenschaftlerInnen lernen und deren Strategien übernehmen (Ureta 2018) sowie die alltäglichen Praktiken der betroffenen Bevölkerung, mit der sie der Verseuchung durch Tailings begegnen, die er als „caring for waste“ bezeichnet (Ureta 2016a; Ureta et al. 2018). Besonders interessant für diese Arbeit ist seine Forschung zusammen mit Álvaro Otaegui zu der Art und Weise, wie dominante Klassifikationsmodelle der Natur (in diesem Fall der Schadstoffbelastung von Böden), die zur Untersuchung in den Naturwissenschaften angewandt werden, zu strategischem Nicht-Wissen führen können (Ureta & Otaegui 2021). Darin zitieren sie McGoey (2012) wie folgt: Strategisches Nicht-Wissen bestehe in „the multifaceted ways that ignorance can be harnessed as a resource, enabling knowledge to be deflected, obscured, concealed or magnified in a way that increases the scope of what remains unintelligible“ (Ureta & Otaegui 2021: 884). Dem fügen sie hinzu, dass in ihrem untersuchten Fall dieses Nicht-Wissen „[…] was explicitly directed towards ignoring most social and politics processes participating in soil formation, hence allowing soil science to maintain the notion of soil as solely a “natural body”“ (ebd.). Diese Naturalisierung lässt sich insbesondere dann vorfinden, wenn der lokale und historische Kontext dieser Taxonomien nicht berücksichtigt wird und kann deutlich beobachtet werden, wenn Klassifikationssysteme von den Industriestaaten unverändert auf den sogenannten globalen Süden übertragen werden. AkteurInnen des globalen Südens besitzen ihnen zufolge kaum Werkzeuge, sich bei den Aushandlungen gegen diese übertragenen Klassifikationssysteme durchzusetzen und auf diese Weise etwa eine ursächliche Schadstoffbelastung durch die Bergbauaktivitäten nachzuweisen (Ureta & Oraegui 2021: 884; Rodríguez Medina 2013: 29). Westliche Bestimmungen werden also in den Peripherien auf lokaler Ebene oft als „Realitäten“ wahrgenommen (da Costa Marques 2014: 85). Dies hat nicht nur praktische, sondern ebenfalls politische Konsequenzen. Durch diese Art der Darstellung und Klassifizierung nach der „natürlichen“ Zusammensetzung der Böden wird die menschliche Intervention und somit auch die Zugabe von Mineralien, (Schwer-)Metallen, Chemikalien und anderer Substanzen während, durch und nach bspw. den Bergbauaktivitäten in de Atacama Region, nicht wahrgenommen und ihre möglichen Konsequenzen nicht beachtet.
Generell lässt sich festhalten, dass die akademische Wissensproduktion über Tailings innerhalb der Sozialwissenschaften äußerst beschränkt ist und auch jene über Chemikalien und andere materielle unsichtbare Schadstoffe in großem Maße von Nicht-Wissen (siehe Kapitel
3) durchdrungen ist. Dies macht sowohl den individuellen als auch den politischen Umgang mit chemischen Substanzen und vor allem mit den von ihnen ausgehenden Gefahren für die menschliche Gesundheit und Ökosysteme zu einer großen Herausforderung mit größtenteils ungewissen und teils unvorhersehbaren Folgen. Umweltregulierungen in diesem Bereich beschränken sich in der Regel auf die Festlegung von Höchstwerten, wobei alles, was sich darunter befindet als unbedenklich und alles darüber als schädlich deklariert wird (Vogel 2008). Sie berücksichtigen dabei, wie in meiner empirischen Arbeit an mehreren Stellen deutlich wird, weder die Folgen der Langzeitexposition noch die Wechselwirkung gleichzeitiger Exposition durch unterschiedliche Chemikalien und Schwermetalle (ebd.; Wehling 2006). Die Nicht-Berücksichtigung dieser Phänomene hat insbesondere im Fall von Tailings für die betroffenen Bevölkerungsgruppen und Gebiete bedeutende Folgen. Deshalb wird seit einigen Jahren von einer Reihe von WissenschaftlerInnen ein „Paradigmenwechsel“ bei der Risikobewertung von Umweltchemikalien vorgeschlagen (Wehling 2006: 303): „Angesichts der ungeheuren Vielzahl umweltrelevanter chemischer Stoffe, der Bandbreite möglicher Wechselwirkungen und der enormen Variabilität von Randbedingungen (ist)
de facto ausgeschlossen, jemals hinreichendes, geschweige denn vollständiges und sicheres Wissen über sämtliche möglichen (Negativ-)Effekte zu gewinnen“ (Scheringer et al. 1998:230 zitiert in Wehling 2006:303). Die Chemikalienpolitik operiere somit „[…] unter Bedingungen unaufhebbaren Nichtwissens“ (Wehling 2006:303). Ansätze wie etwa solche der
environmental justice plädieren deshalb für einen mit naturwissenschaftlich Überlegungen begründeten Vorsorge-orientierten Umgang mit wissenschaftlichem Nicht-Wissen
67. Andere WissenschaftlerInnen wie etwa Ureta & Flores (2022) schlagen in dieser Hinsicht die Anwendung von
politics of weakness vor, die das Nicht-Wissen und die daraus resultierende Unmöglichkeit von Prognosen und Lösungsstrategien vorausschauend miteinbeziehen. Die angeführten Ansätze widmen sich – wie wir gesehen haben – Fragestellungen, die meinem Fokus, der sich auf die Beziehungen von Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit, Wissen/Nicht-Wissen und
action/inaction richtet, in spezifischen Aspekten ähneln. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag für meine Arbeit, besonders was die Beziehung zwischen Wissensproduktion und unsichtbaren Schadstoffen angeht. Allerdings wird im Folgenden deutlich, dass meine Forschung zudem einen weitaus stärkeren Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Handlungen der beteiligten Akteure, auf die Unsichtbarkeit der Tailings sowie auf Fragen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, sozio-ökonomischen Prozessen und sozial-ökologischen Konfliktdynamiken legt. Dadurch wird es möglich zu zeigen, warum Tailings gesellschaftlich unsichtbar bleiben, nicht „gewusst“ werden oder nicht zu problemorientiertem Handeln der lokalen Bevölkerung führen. Um dies deutlich zu machen, werde ich im Folgenden meine Forschungsfrage und meine zentralen Thesen explizit darlegen, um anschließend zur Forschungsheuristik überzugehen.