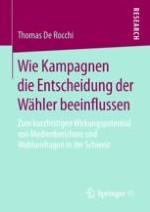2018 | OriginalPaper | Buchkapitel
9. Warum Wählerinnen ihre Präferenzen kurzfristig wechseln – und welche Parteien davon profitieren
verfasst von : Thomas De Rocchi
Erschienen in: Wie Kampagnen die Entscheidung der Wähler beeinflussen
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by