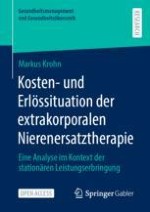4.1 Zielsetzung und Kapitelaufbau
4.2 Methodik
4.2.1 Datensatzbeschreibung
4.2.1.1 Intermittierende Verfahren
4.2.1.1.1 Prozesse und Prozesszeiten
-
Gerätevorbereitung: Anschluss benötigter Materialen, Gerätestart, Eingabe der Patientendaten, Kontrolle des Gerätes und des Aufbaus, bei Verfahren auf externen Stationen zusätzlich Verstauen der Materialien in Transportbehälter sowie Platzierung des Dialysegerätes in Patientennähe
-
Anschluss: Aus- und Umkleiden des Patienten, Wiegen, Lagern, Anschluss ans Monitoring, Anschluss mittels Dialysekatheter oder Shunt, Blutprobenentnahme, Anschluss an das Dialysegerät, Einstellungen der Antikoagulation
-
Labor: Durchführung aller Blutuntersuchungen am Analysegerät inklusive zugehöriger Wege, bei Einsatz der Antikoagulation mehrmalige Durchführung während Behandlung
-
Abschluss: Trennung des Schlauchsystems, Katheterpflege und Blockung bei Abschluss vom Dialysekatheter, Entfernung der Kanülen und Abdrücken der Punktionsstellen bei Dialyseshunt, Abschluss vom Monitoring, An- bzw. Umkleiden des Patienten
-
Gerätenachbereitung: Abbau Infusomat, Entsorgung benötigter Verbrauchsmaterialien, Start des Gerätereinigungsmodus, Desinfektion des gesamten Arbeitsplatzes, auf externen Stationen zusätzlich Trennung des Dialysegerätes von benötigten Anschlüssen und Platzierung des Gerätes am Lagerort
-
Betreuung: Reaktion auf Gerätealarme, Entnahme von Blutproben, Monitoring, Patientengespräche und Unterstützung
-
Dokumentation: Protokollführung zwischen An- und Abschluss, Dialyseprotokoll, bei Antikoagulation mit Citrat zusätzlich Citratprotokoll
-
Stationsarbeit: Kontrolle von Lagerbeständen, Materialbestellungen, Kontrolle und Einlagerung von Warenlieferungen, Entsorgung, Kontakt zu vor- oder nachgelagerten Behandlungspartnern, Anforderung von Behandlungsunterlagen, Anmeldungen beim Transportdienst, Vorbereitung von Dialyseprotokollen, Archivierung von Patientenakten, Protokollführung, Überprüfung Notfallkoffer, Temperaturkontrollen von Kühleinheiten, Haltbarkeitsprüfung von Verbrauchsmaterialien
-
Wege: Notwendige Wegezeiten für die Leistungserbringung auf Intensivstationen (Wert gibt die Gesamtzeit aller Wegezeiten für eine intermittierende Dialyse an)
|
Einflussparameter
|
Gerätevorbereitung in s
|
Anschluss in s
|
Labor in s
|
Abschluss in s
|
Gerätenachbereitung in s
|
Betreuung in s
|
Dokumentation in s
|
n
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamt
|
Mittelwert
|
840
|
1.387
|
389
|
930
|
678
|
1.021
|
721
|
68
|
|
Standardabweichung
|
338
|
642
|
272
|
394
|
314
|
818
|
417
|
||
|
HD
|
Mittelwert
|
848
|
1.393
|
394
|
918
|
684
|
1.016
|
732
|
66
|
|
Standardabweichung
|
339
|
651
|
274
|
391
|
312
|
826
|
417
|
||
|
HDF
|
Mittelwert
|
577
|
1.193
|
228
|
1.310
|
484
|
1.179
|
361
|
2
|
|
Standardabweichung
|
209
|
8
|
98
|
411
|
443
|
663
|
288
|
||
|
Heparin
|
Mittelwert
|
828
|
1.317
|
262
|
918
|
655
|
1.044
|
650
|
51
|
|
Standardabweichung
|
363
|
630
|
120
|
418
|
315
|
871
|
408
|
||
|
Citrat
|
Mittelwert
|
876
|
1.599
|
770
|
963
|
748
|
951
|
937
|
17
|
|
Standardabweichung
|
254
|
649
|
243
|
321
|
306
|
651
|
377
|
||
|
Shunt
|
Mittelwert
|
878
|
1.499
|
385
|
1.096
|
581
|
980
|
648
|
24
|
|
Standardabweichung
|
324
|
645
|
237
|
436
|
276
|
820
|
327
|
||
|
Katheter
|
Mittelwert
|
819
|
1.327
|
391
|
839
|
731
|
1.043
|
762
|
44
|
|
Standardabweichung
|
348
|
640
|
291
|
341
|
323
|
825
|
457
|
|
Einflussparameter
|
Gerätevorbereitung in s
|
Anschluss in s
|
Labor in s
|
Abschluss in s
|
Gerätenachbereitung in s
|
Betreuung in s
|
Dokumentation in s
|
Wege in s
|
n
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamt (HD)
|
Mittelwert
|
1.515
|
978
|
66
|
1.020
|
463
|
960
|
425
|
1.795
|
17
|
|
Standardabweichung
|
570
|
375
|
271
|
399
|
245
|
2.955
|
249
|
353
|
||
|
Heparin
|
Mittelwert
|
1.480
|
1.014
|
0
|
1.060
|
452
|
256
|
394
|
1.814
|
16
|
|
Standardabweichung
|
570
|
356
|
0
|
376
|
249
|
570
|
220
|
355
|
||
|
Citrat
|
Mittelwert
|
2.062
|
405
|
1.116
|
381
|
629
|
12.225
|
924
|
1.490
|
1
|
|
Standardabweichung
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||
|
Shunt
|
Mittelwert
|
1.623
|
1.099
|
0
|
1.275
|
396
|
390
|
363
|
1.889
|
10
|
|
Standardabweichung
|
665
|
304
|
0
|
278
|
194
|
698
|
170
|
413
|
||
|
Katheter
|
Mittelwert
|
1.545
|
679
|
279
|
546
|
623
|
3.106
|
574
|
1.620
|
4
|
|
Standardabweichung
|
368
|
365
|
558
|
218
|
305
|
6.079
|
348
|
266
|
||
|
ECMO
|
Mittelwert
|
1.113
|
975
|
0
|
805
|
474
|
0
|
435
|
1.716
|
3
|
|
Standardabweichung
|
314
|
506
|
0
|
111
|
314
|
0
|
344
|
75
|
-
Visite, Behandlung: Alle auf der Dialyseabteilung bzw. externen Stationen durchführten diagnostischen oder therapeutischen Tätigkeiten am Patienten. Hierbei ist zu beachten, dass die Zeitwerte stets den Bezug „je Dialyse“ haben. Auf der Dialyseabteilung ergibt sich der Zeitwert direkt durch die Beobachtung am Patienten, auf Intensivstationen ergibt er sich aus dem Quotienten der gesamten Visitedauer und der Anzahl der Patienten, bei denen am entsprechenden Tag ein intermittierendes Dialyseverfahren bzw. ein An- bzw. Abschluss bzw. Wechsel eines kontinuierlichen Verfahrens stattgefunden hat.
-
Dokumentation (inkl. Überwachung, Organisation): Hierin enthalten sind alle anfallenden administrativen Aufgaben auf der Dialyseabteilung. Die ermittelte Gesamtzeit wird über alle am jeweiligen Tag behandelten Dialysepatienten verteilt.
-
Lehre: Während der Studiendurchführung wurden Lehrtätigkeiten am Patientenbett durchgeführt. Um keine Verzerrungen auftreten zu lassen – da der Ärztliche Dienst in diesem Zeitraum für Tätigkeiten auf der Dialyseabteilung zu Verfügung stand – werden diese Zeiten im Folgenden mit in den Prozessblock „Dokumentation“ integriert.
-
Konsile: Im Rahmen der Untersuchung wurden ebenfalls Konsile für Dritte erfasst. Diese sollen im Verlauf der weiteren Analyse jedoch keine Beachtung finden.
-
Wege: Für Patienten auf Intensivstationen wurde die anteilige Wegezeit berechnet. Methodisch ergibt sich diese wie im Bereich der „Visite, Behandlung“ als Quotienten der Gesamtwegedauer und der Anzahl der Patienten, bei denen am entsprechenden Tag ein intermittierendes Dialyseverfahren bzw. ein An- bzw. Abschluss bzw. Wechsel eines kontinuierlichen Verfahrens stattgefunden hat.
|
Visite auf Dialyseabteilung in s
|
Visite auf Intensivstation in s
|
Wegezeit in s
|
Dokumentation in s
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Mittelwert in s
|
498
|
449
|
245
|
1.681
|
|
Standardabweichung in s
|
756
|
161
|
52
|
478
|
|
n
|
53
|
15
|
15
|
68
|
4.2.1.1.2 Materialkosten
|
Verfahren
|
Gesamtkosten in €
|
|---|---|
|
F-C-K-DN
|
64,09
|
|
F-C-K-SN
|
66,41
|
|
F-C-S-DN
|
64,24
|
|
F-C-S-SN
|
65,96
|
|
F-H-K-DN
|
44,19
|
|
F-H-K-SN
|
46,52
|
|
F-H-S-DN
|
44,34
|
|
F-H-S-SN
|
46,07
|
|
G-C-K-DN
|
62,61
|
|
G-C-K-SN
|
66,19
|
|
G-C-S-DN
|
62,76
|
|
G-C-S-SN
|
65,75
|
|
G-H-K-DN
|
42,72
|
|
G-H-K-SN
|
46,30
|
|
G-H-S-DN
|
42,87
|
|
G-H-S-SN
|
45,86
|
|
F = Fresenius – G = Gambro
H = Heparin – C = Citrat
K = Katheter – S = Shunt
DN = Double-Needle – SN = Single-Needle
|
|
|
Verfahren
|
Gesamtkosten in €
|
|---|---|
|
C-K
|
64,24
|
|
C-S
|
64,21
|
|
H-K
|
44,34
|
|
H-S
|
44,31
|
|
H = Heparin – C = Citrat
K = Katheter – S = Shunt
|
|
4.2.1.2 Kontinuierliche Verfahren
4.2.1.2.1 Prozesse und Prozesszeiten
-
Vorbereitung auf Dialyseabteilung: Kommissionieren benötigter Verbrauchsmaterialien
-
Wegezeit (Hin): Weg von der Dialyseabteilung zur Intensivstation bis ins Patientenzimmer inklusive Anlage benötigter Schutzkleidung
-
Gerätevorbereitung: Beschaffung Verbrauchsmaterialien, Start des Dialysegerätes, Bestückung mit Dialysatbeuteln, bei CVVHD mit Citrat Anschluss der Citrat-Calcium-Lösung, Anbringen Filtratbeutel, Prüfung des Geräteaufbaus (Testlauf)
-
Anschluss: Anschluss des Schlauchsystems an den Gefäßzugang, Einstellung am Dialysegerät zu Blutfluss, Dialysatfluss, Citratdosis und Calciumdosis, Start der Blutpumpe, Entnahme Blutprobe, Laboruntersuchung, Dokumentation im Informationssystem, eventuell Änderung von Geräteeinstellungen, Müllentsorgung
-
Abschluss: Stoppen des Gerätes, Trennen des Patienten vom Gerät, Blockung des Gefäßzugangs
-
Gerätenachbereitung: Start des Gerätereinigungsmodus, Abbau verwendeter Verbrauchsmaterialien, Entleerung Filtratbeutel, Gerätedesinfektion, Müllentsorgung
-
Wegezeit (Rück): Weg von der Intensivstation zur Dialyseabteilung
-
Nachbereitung auf Dialyseabteilung: Tätigkeitsdokumentation, Terminplanung anstehender Verfahren, Materialbestellungen, Lagerbestandskontrolle
|
Einflussparameter
|
Gerätevorbereitung
|
Anschluss
|
Abschluss
|
Gerätenachbereitung
|
Weg (Hin)
|
Weg (Rück)
|
Vor- und Nachbereitung auf Dialyseabteilung
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamt
|
Mittelwert in s
|
1.418
|
792
|
450
|
501
|
215
|
151
|
312
|
|
Standardabweichung in s
|
461
|
509
|
156
|
391
|
53
|
26
|
223
|
|
|
n
|
21
|
19
|
17
|
19
|
15
|
11
|
22
|
|
|
CVVH-H
|
Mittelwert in s
|
1.143
|
624
|
551
|
783
|
226
|
155
|
170
|
|
Standardabweichung in s
|
309
|
614
|
167
|
694
|
65
|
24
|
152
|
|
|
n
|
5
|
5
|
3
|
5
|
7
|
5
|
7
|
|
|
CVVHD-C
|
Mittelwert in s
|
1.484
|
836
|
432
|
427
|
210
|
150
|
358
|
|
Standardabweichung in s
|
472
|
488
|
152
|
246
|
48
|
27
|
225
|
|
|
n
|
21
|
19
|
17
|
19
|
15
|
11
|
22
|
-
Geräteeinstellungen: Reaktion auf Gerätealarme, Einstellungen am Gerät
-
Wechsel-Dialysatbeutel: Wechsel der Verbrauchsmaterialien
-
Wechsel-Citratbeutel: Wechsel von Verbrauchsmaterialien der Citratverfahren (Citrat, Calcium)
-
Entleerung Filtratbeutel: Entleerung in den Abfluss
-
Materialbeschaffung: Bereitstellung neuer Dialysatbeutel, Citratbeutel aus dem Lager
|
Uhrzeit und Einflussparameter
|
Geräteeinstellungen in s
|
Wechsel-Dialysatbeutel in s
|
Wechsel-Citratbeutel in s
|
Entleerung Filtratbeutel in s
|
Materialbeschaffung in s
|
n
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6–10 Uhr
|
|||||||
|
Gesamt
|
Mittelwert
|
64
|
59
|
31
|
215
|
48
|
23
|
|
Standardabweichung
|
122
|
104
|
60
|
144
|
100
|
||
|
CVVH-H
|
Mittelwert
|
43
|
169
|
0
|
257
|
97
|
5
|
|
Standardabweichung
|
77
|
171
|
0
|
76
|
132
|
||
|
CVVHD-C
|
Mittelwert
|
70
|
28
|
40
|
204
|
34
|
18
|
|
Standardabweichung
|
133
|
50
|
65
|
158
|
88
|
||
|
10–14 Uhr
|
|||||||
|
Gesamt
|
Mittelwert
|
54
|
60
|
23
|
247
|
55
|
17
|
|
Standardabweichung
|
80
|
110
|
39
|
192
|
107
|
||
|
CVVH-H
|
Mittelwert
|
106
|
36
|
0
|
433
|
101
|
3
|
|
Standardabweichung
|
137
|
62
|
0
|
100
|
176
|
||
|
CVVHD-C
|
Mittelwert
|
42
|
66
|
28
|
207
|
45
|
14
|
|
Standardabweichung
|
66
|
119
|
41
|
185
|
94
|
||
|
14–18 Uhr
|
|||||||
|
Gesamt
|
Mittelwert
|
168
|
175
|
17
|
378
|
63
|
7
|
|
Standardabweichung
|
258
|
97
|
30
|
207
|
83
|
||
|
CVVH-H
|
Mittelwert
|
368
|
171
|
0
|
370
|
87
|
2
|
|
Standardabweichung
|
508
|
49
|
0
|
121
|
122
|
||
|
CVVHD-C
|
Mittelwert
|
88
|
176
|
24
|
381
|
53
|
5
|
|
Standardabweichung
|
87
|
117
|
33
|
246
|
79
|
||
|
18–22 Uhr
|
|||||||
|
Gesamt
|
Mittelwert
|
44
|
31
|
25
|
303
|
76
|
7
|
|
Standardabweichung
|
49
|
44
|
44
|
83
|
95
|
||
|
CVVH-H
|
Mittelwert
|
0
|
0
|
0
|
173
|
168
|
1
|
|
Standardabweichung
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||
|
CVVHD-C
|
Mittelwert
|
51
|
37
|
29
|
325
|
61
|
6
|
|
Standardabweichung
|
50
|
46
|
47
|
66
|
95
|
||
-
Visite: Auf externen Stationen durchgeführte Visite. Konträr zur Erhebung der intermittierenden Verfahren ergibt sich der Wert nicht aus dem Quotienten der gesamten Visitedauer und der Anzahl der Patienten, bei denen am entsprechenden Tag ein intermittierendes Dialyseverfahren bzw. ein An- bzw. Abschluss bzw. Wechsel eines kontinuierlichen Verfahrens stattgefunden hat, sondern als Quotient aus der gesamten Visitedauer und der Anzahl an dialysepflichtigen Patienten, egal ob am Beobachtungstag ein Anschluss, Abschluss oder Wechsel bei einem kontinuierlichen Verfahren stattgefunden hat oder ob ein intermittierendes Verfahren durchgeführt wurde.
-
Wege: Für Patienten auf Intensivstationen wurde die anteilige Wegezeit berechnet. Auch hier wird die Wegezeit wie bei der Visite über alle dialysepflichtigen Patienten verteilt und nicht wie in der Erhebung der intermittierenden Verfahren über die Anzahl der Patienten, die am entsprechenden Tag ein intermittierendes Verfahren oder einen Anschluss, Abschluss oder Wechsel an ein kontinuierlichen Verfahren erhalten haben.
|
Visite auf Intensivstation
|
Wegezeit
|
|
|---|---|---|
|
Mittelwert in s
|
177
|
107
|
|
Standardabweichung in s
|
70
|
27
|
|
n
|
61
|
61
|
4.2.1.2.2 Personal- und Materialkosten
|
CVVH
|
CVVHD
|
|
|---|---|---|
|
Anschuss
|
145,05 €
|
168,13 €
|
|
Abschluss
|
3,31 €
|
3,31 €
|
|
Wechsel ohne Katheterblockung
|
146,30 €
|
169,38 €
|
|
Wechsel mit Katheterblockung
|
147,12 €
|
170,20 €
|
|
Therapiebedingter Abschluss
|
3,44 €
|
3,44 €
|
4.2.2 Datenaufbereitung
4.2.2.1 Definition von Einflussfaktoren
-
Die Mittelwerte der Prozesse „Labor“ sowie „Dokumentation“ weichen beim bei der Unterscheidung zwischen Heparin vs. Citrat signifikant voneinander ab (p < 0,001 bzw. p = 0,012)
-
Die Mittelwerte der Prozesse „Abschluss“ und „Gerätenachbereitung“ weichen bei der Unterscheidung zwischen Shunt vs. Katheter signifikant voneinander ab (p = 0,016 bzw. p = 0,050)
-
Für die Prozesse „Gerätevorbereitung“, „Anschluss“ und „Betreuung“ existieren keine signifikanten Einflussparameter.
-
Werden die Prozesse „An- bzw. Abschluss“ sowie „Gerätevor- und Nachbereitung“ als verbundene Stichproben betrachtet und je die Summe der zwei Teilprozesse auf Einflussparameter geprüft, so ergibt es sich, dass die Mittelwerte der Prozesse „Ab- bzw. Abschluss“ bei der Unterscheidung nach Shunt vs. Katheter signifikant voneinander abweichen (p = 0,044), bei der „Gerätevor- und Nachbereitung“ jedoch keine signifikanten Einflussparameter existieren.
-
„Labor“ und „Dokumentation“ mit Einflussparameter „Antikoagulation“
-
„Anschluss“ und „Abschluss“ mit Einflussparameter „Gefäßzugang“
-
„Gerätevorbereitung“, „Gerätenachbereitung“ sowie „Betreuung“ ohne Einflussparameter
-
Die Prozesse „Labor“ sowie „Dokumentation“ fallen nur bei Patienten mit der Antikoagulation Citrat an.
-
Die Mittelwerte des Prozesses „Abschluss“ mit den Unterscheidungen zwischen Shunt, Katheter oder ECMO weichen für Shunt vs. Katheter, Shunt vs. ECMO sowie kombiniert Katheter/ECMO vs. Shunt signifikant voneinander ab (p = 0,001, p = 0,002, p < 0,001), für ECMO vs. Katheter resultieren kein signifikantes Ergebnis.
-
Für die Prozesse „Gerätevorbereitung“, „Anschluss“, „Gerätenachbereitung“, „Wege“ sowie „Betreuung“ existiert keine signifikanten Einflussparameter, wobei bei Einsatz der Antikoagulation mittels Citrat zusätzlich ein Prozess der 1:1-Betreuung hinzukommt.
-
Wird der Prozess „An- bzw. Abschluss“ als verbundene Stichprobe betrachtet und die Summe der zwei Teilprozesse auf Einflussparameter geprüft, so ergibt es sich, dass die Mittelwerte der Prozess „Ab- bzw. Abschluss“ bei der Unterscheidung nach Shunt vs. Katheter bzw. nach ECMO/Katheter vs. Shunt signifikant voneinander unterscheiden (p = 0,003, p = 0,003).
-
„Labor“, „Dokumentation“, „Betreuung (1:1-Erfordernis bei Citrateinsatz)“ mit Einflussparameter „Antikoagulation“
-
„Anschluss“ und „Abschluss“ mit Einflussparameter „Gefäßzugang“
-
„Gerätevorbereitung“, „Gerätenachbereitung“ sowie „Wege“ ohne Einflussparameter
-
Der Mittelwert des Prozesses „Materialbeschaffung“ ist abhängig von der Antikoagulation (p = 0,024).
-
Für die Prozesse „Gerätevorbereitung“, „Anschluss“, „Abschluss“, „Gerätenachbereitung“, „Weg hin“ sowie „Weg zurück“ existieren keine signifikanten Einflussparameter.
4.2.2.2 Erstellung einer Definitionslogik und Datenumformung der Personaleinsatzzeiten
-
Dialysepflege, Intensivpflege, Ärztlicher Dienst
-
Verfahren auf Dialyseabteilung oder externer Station
-
intermittierendes bzw. kontinuierliches Verfahren
-
Antikoagulation mittels Heparin bzw. Citrat
-
Gefäßzugang mittels Dialysekatheter (inkl. ECMO) bzw. Dialyseshunt
|
–
|
A
|
Ärztlicher Dienst
|
|
–
|
D
|
Dialysepflege
|
|
–
|
I
|
Intensivpflege
|
|
–
|
i
|
intermittierendes Verfahren
|
|
–
|
c
|
kontinuierliches Verfahren
|
|
–
|
d
|
Dialyseabteilung
|
|
–
|
e
|
Intensivstation
|
|
–
|
x
|
keine Unterscheidung
|
|
–
|
GV
|
Gerätevorbereitung
|
|
–
|
AN
|
Anschluss
|
|
–
|
LA
|
Labor
|
|
–
|
AB
|
Abschluss
|
|
–
|
GN
|
Gerätenachbereitung
|
|
–
|
BE
|
Betreuung
|
|
–
|
DO
|
Dokumentation
|
|
–
|
ST
|
Stationsarbeit
|
|
–
|
WE
|
Wegezeit19
|
|
–
|
WH
|
Wegezeit-Hin
|
|
–
|
WR
|
Wegezeit-Rück
|
|
–
|
VI
|
Visite20
|
|
–
|
VN
|
Vor- und Nachbereitung auf Dialyseabteilung
|
|
–
|
GE
|
Geräteeinstellungen
|
|
–
|
WD
|
Wechsel Dialysatbeutel
|
|
–
|
WC
|
Wechsel Citratbeutel
|
|
–
|
EF
|
Entleerung Filtratbeutel
|
|
–
|
MB
|
Materialbeschaffung
|
|
–
|
H
|
Heparin
|
|
–
|
C
|
Citrat
|
|
–
|
K
|
Dialysekatheter (inkl. ECMO)
|
|
–
|
S
|
Dialyseshunt
|
|
–
|
X
|
keine Unterscheidung
|
|
Akronym
|
Personalkategorie
|
Intermittierend vs. kontinuierlich
|
Dialyseabteilung vs. Intensivstation
|
Prozess
|
Abhängigkeit
|
|---|---|---|---|---|---|
|
DidGVX
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Gerätevorbereitung
|
unabhängig
|
|
DidGNX
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Gerätenachbereitung
|
unabhängig
|
|
DidBEX
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Betreuung
|
unabhängig
|
|
DidANS
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Anschluss
|
Shunt
|
|
DidABS
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Abschluss
|
Shunt
|
|
DidANK
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Anschluss
|
Katheter
|
|
DidABK
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Abschluss
|
Katheter
|
|
DidLAH
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Labor
|
Heparin
|
|
DidDOH
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Dokumentation
|
Heparin
|
|
DidLAC
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Labor
|
Citrat
|
|
DidDOC
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Dokumentation
|
Citrat
|
|
DieGVX
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Gerätevorbereitung
|
unabhängig
|
|
DieGNX
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Gerätenachbereitung
|
unabhängig
|
|
DieWEX
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Wegezeiten
|
unabhängig
|
|
DieANS
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Anschluss
|
Shunt
|
|
DieABS
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Abschluss
|
Shunt
|
|
DieANK
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Anschluss
|
Katheter
|
|
DieABK
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Abschluss
|
Katheter
|
|
DieBEH
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Betreuung
|
Heparin
|
|
DieDOH
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Dokumentation
|
Heparin
|
|
DieLAC
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Labor
|
Citrat
|
|
DieBEC
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Betreuung
|
Citrat
|
|
DieDOC
|
Dialysepflege
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Dokumentation
|
Citrat
|
|
DixST
|
Dialysepflege
|
intermittierend21
|
unabhängig
|
Stationsarbeit
|
unabhängig
|
|
DceGVX
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Gerätevorbereitung
|
unabhängig
|
|
DceANX
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Anschluss
|
unabhängig
|
|
DceABX
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Abschluss
|
unabhängig
|
|
DceGNX
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Gerätenachbereitung
|
unabhängig
|
|
DceWHX
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wegezeit Hinweg
|
unabhängig
|
|
DceWRX
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wegezeit Rückweg
|
unabhängig
|
|
DceVNH
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Vor-/Nachbereitung
|
Heparin
|
|
DceVNC
|
Dialysepflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Vor-/Nachbereitung
|
Citrat
|
|
AidVIX
|
Ärztlicher Dienst
|
intermittierend
|
Dialyseabteilung
|
Visite
|
unabhängig
|
|
AieVIX
|
Ärztlicher Dienst
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Visite
|
unabhängig
|
|
AceVIX
|
Ärztlicher Dienst
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Visite
|
unabhängig
|
|
AieWEX
|
Ärztlicher Dienst
|
intermittierend
|
Intensivstation
|
Wegezeit
|
unabhängig
|
|
AceWEX
|
Ärztlicher Dienst
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wegezeit
|
unabhängig
|
|
AixDOX
|
Ärztlicher Dienst
|
intermittierend22
|
unabhängig
|
Dokumentation
|
unabhängig
|
|
IceGE0610
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Geräteeinstellungen
|
unabhängig
|
|
IceWD0610
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Dialysatbeutel
|
unabhängig
|
|
IceEF0610
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Entleerung Filtratbeutel
|
unabhängig
|
|
IceMB0610
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Materialbeschaffung
|
unabhängig
|
|
IceGE1014
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Geräteeinstellungen
|
unabhängig
|
|
IceWD1014
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Dialysatbeutel
|
unabhängig
|
|
IceEF1014
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Entleerung Filtratbeutel
|
unabhängig
|
|
IceMB1014
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Materialbeschaffung
|
unabhängig
|
|
IceGE1418
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Geräteeinstellungen
|
unabhängig
|
|
IceWD1418
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Dialysatbeutel
|
unabhängig
|
|
IceEF1418
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Entleerung Filtratbeutel
|
unabhängig
|
|
IceMB1418
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Materialbeschaffung
|
unabhängig
|
|
IceGE1822
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Geräteeinstellungen
|
unabhängig
|
|
IceWD1822
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Dialysatbeutel
|
unabhängig
|
|
IceEF1822
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Entleerung Filtratbeutel
|
unabhängig
|
|
IceMB1822
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Materialbeschaffung
|
unabhängig
|
|
IceWC0610
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Citratbeutel
|
Citrat
|
|
IceWC1014
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Citratbeutel
|
Citrat
|
|
IceWC1418
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Citratbeutel
|
Citrat
|
|
IceWC1822
|
Intensivpflege
|
kontinuierlich
|
Intensivstation
|
Wechsel Citratbeutel
|
Citrat
|
|
Uhrzeit und Einflussparameter
|
Geräteeinstellungen (unabhängig)
|
Wechsel-Dialysatbeutel (unabhängig)
|
Wechsel-Citratbeutel (Citrat)
|
Entleerung Filtratbeutel (unabhängig)
|
Materialbeschaffung (unabhängig)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6–10 Uhr
|
Mittelwert in s
|
123
|
169
|
119
|
247
|
220
|
|
Eintr.wahrsch.
|
52,17 %
|
34,78 %
|
33,33 %
|
86,96 %
|
21,74 %
|
|
|
10–14 Uhr
|
Mittelwert in s
|
114
|
205
|
78
|
323
|
235
|
|
Eintr.wahrsch.
|
47,06 %
|
29,41 %
|
35,71 %
|
76,47 %
|
23,53 %
|
|
|
14–18 Uhr
|
Mittelwert in s
|
114
|
205
|
78
|
323
|
235
|
|
Eintr.wahrsch.
|
47,06 %
|
29,41 %
|
35,71 %
|
76,47 %
|
23,53 %
|
|
|
18–22 Uhr
|
Mittelwert in s
|
77
|
73
|
87
|
303
|
178
|
|
Eintr.wahrsch.
|
57,14 %
|
42,86 %
|
33,33 %
|
100,00 %
|
42,86 %
|
4.2.3 Modellierung
4.2.3.1 Vorbemerkung
4.2.3.2 Verteilungsidentifikation und Bildung von Prozessblöcken
-
unabhängige Prozesse – Did__X
-
Abhängigkeit Shunt – Did__S
-
Abhängigkeit Katheter – Did__K
-
Abhängigkeit Heparin – Did__H
-
Abhängigkeit Citrat – Did__C
-
unabhängigen Prozesse – Die__X
-
Abhängigkeit Shunt – Die__S
-
Abhängigkeit Katheter – Die__K
-
Abhängigkeit Heparin – Die__H
-
Abhängigkeit Citrat – Die__C
-
unabhängige Prozesse – Dce__X
-
Abhängigkeit Heparin – Dce__H
-
Abhängigkeit Citrat – Dce__C
4.2.3.3 Auswertung nach Anzahl der Einflussfaktoren
-
aidH – Anteil intermittierender Verfahren mit Heparin auf Dialyseabteilung
-
aidK – Anteil intermittierender Verfahren mit Katheter auf Dialyseabteilung
-
aieH – Anteil intermittierender Verfahren mit Heparin auf Intensivstation
-
aieK – Anteil intermittierender Verfahren mit Katheter auf Intensivstation
-
aid – Anteil intermittierender Verfahren auf Dialyseabteilung
-
Zeiten für Visiten und Wege fallen jeden Tag während der Behandlung an, da bei einer Laufzeit von z. B. 72 Stunden jedoch auch am Tag des Anschlusses sowie Abschlusses Visiten anfallen, wird die Anzahl der Visiten bzw. Wege als „round(tce/24) + 1“ definiert
-
Der Dokumentationsaufwand AixDOX, erhoben während der Analyse der intermittierenden Verfahren gilt ebenso für kontinuierliche Verfahren. Der entsprechende Aufwand wird für jeden Wechsel sowie für den Tag des Anschlusses und des Abschlusses angesetzt. Er wird über den Ausdruck „(round(tce-36,1)/72) + 2“ definiert.
4.2.3.4 Integration von Personal und Materialkosten
|
–
|
kD
|
Minutensatz Dialysepersonal
|
|
–
|
kA
|
Minutensatz Ärztlicher Dienst
|
|
–
|
kI
|
Minutensatz Intensivpflegepersonal
|
-
mixKH – bei Verwendung von Katheter und Heparin
-
mixKC – bei Verwendung von Katheter und Citrat
-
mixSH – bei Verwendung von Shunt und Heparin
-
mixSC – bei Verwendung von Shunt und Citrat
-
mixK
-
mixS
-
mixH
-
mixC
-
mid
-
mie
-
mix
-
mceANH
-
mceCHH
-
mceABH
-
mceCHC
-
mceABC
4.2.3.5 Gesamtübersicht Monte-Carlo-Simulation
-
sDieBEC (Notwendigkeit einer 1:1-Betreuung bei intermittierenden Dialysen mit Citrat auf Intensivstationen [ja = 1; nein = 0]
-
sDixSTX – Einbezug der Stationsarbeit [ja = 1; nein = 0]
-
sAixDOX – Einbezug Dokumentations-/ Überwachungsaufwand [ja = 1; nein = 0]
-
skI – Einbezug der Kosten des Intensivpflegepersonals [ja = 1; nein = 0]
-
kD, kA, kI – Personalminutensätze des Dialysepersonals, der Intensivpflege, des Ärztlichen Dienstes
-
aidH, aidK, aieH, aieK, aid, aceH – Anteile zum Gefäßzugang, zur Antikoagulation und zum Behandlungsort
-
tce – Laufzeit eines kontinuierlichen Dialyseverfahrens
4.2.3.6 Definition der Basisinputs
|
OPS-Kode
|
Szenario – P-UMG 2019
|
|---|---|
|
8–853.7
|
11,92 %
|
|
8–853.8
|
0,12 %
|
|
8–854.2
|
28,67 %
|
|
davon „innen“
|
79,43 %
|
|
davon „außen“
|
20,57 %
|
|
8–854.3
|
25,01 %
|
|
davon „innen“
|
58,08 %
|
|
davon „außen“
|
41,92 %
|
|
8–854.4
|
2,80 %
|
|
8–854.6
|
3,99 %
|
|
8–854.7
|
27,26 %
|
|
SONSTIGE
|
0,22 %
|
4.3 Ergebnisse
4.3.1 Vorbemerkungen
-
Mittelwert
-
Standardabweichung
-
Median
-
90. Perzentil
-
Minimum
-
Maximum
-
Homogenitätskoeffizient
4.3.2 Prozesszeiten
4.3.2.1 Dialysepflege
4.3.2.1.1 Intermittierende Verfahren
4.3.2.1.1.1 Differenzierung nach drei Einflussparametern
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Did_Katheter_Heparin
|
8.798
|
2.076
|
8.564
|
11.555
|
3.935
|
18.944
|
0,81
|
|
Did_Katheter_Citrat
|
9.588
|
2.046
|
9.353
|
12.312
|
4.691
|
19.893
|
0,82
|
|
Did_Shunt_Heparin
|
9.281
|
2.096
|
9.065
|
12.055
|
4.048
|
21.230
|
0,82
|
|
Did_Shunt_Citrat
|
10.071
|
2.094
|
9.834
|
12.856
|
4.651
|
20.897
|
0,83
|
|
Die_Katheter_Heparin
|
9.048
|
1.878
|
8.826
|
11.562
|
4.630
|
21.509
|
0,83
|
|
Die_Katheter_Citrat
|
22.787
|
1.857
|
22.556
|
25.302
|
18.417
|
34.858
|
0,92
|
|
Die_Shunt_Heparin
|
9.959
|
1.866
|
9.716
|
12.509
|
5.277
|
21.278
|
0,84
|
|
Die_Shunt_Citrat
|
23.699
|
1.845
|
23.454
|
26.230
|
19.312
|
34.626
|
0,93
|
4.3.2.1.1.2 Differenzierung nach zwei Einflussparametern
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Did_Katheter
|
9.107
|
2.099
|
8.867
|
11.946
|
4.139
|
19.569
|
0,81
|
|
Did_Shunt
|
9.590
|
2.135
|
9.353
|
12.447
|
4.048
|
21.230
|
0,82
|
|
Die_Katheter
|
17.881
|
6.845
|
21.323
|
24.644
|
4.630
|
34.858
|
0,72
|
|
Die_Shunt
|
18.792
|
6.836
|
22.246
|
25.562
|
5.602
|
34.626
|
0,73
|
|
Did_Heparin
|
9.113
|
2.096
|
8.893
|
11.923
|
4.139
|
21.230
|
0,81
|
|
Did_Citrat
|
9.903
|
2.082
|
9.658
|
12.698
|
4.934
|
20.897
|
0,83
|
|
Die_Heparin
|
9.353
|
1.930
|
9.142
|
11.922
|
4.630
|
21.509
|
0,83
|
|
Die_Citrat
|
23.093
|
1.908
|
22.878
|
25.628
|
18.609
|
34.858
|
0,92
|
|
(Dix_)Katheter_Heparin
|
8.862
|
2.009
|
8.651
|
11.558
|
3.935
|
18.944
|
0,82
|
|
(Dix_)Katheter_Citrat
|
13.642
|
6.417
|
10.604
|
23.414
|
4.691
|
30.683
|
0,68
|
|
(Dix_)Shunt_Heparin
|
9.487
|
2.043
|
9.279
|
12.214
|
4.048
|
21.230
|
0,82
|
|
(Dix_)Shunt_Citrat
|
14.267
|
6.611
|
11.154
|
24.329
|
4.651
|
31.278
|
0,68
|
4.3.2.1.1.3 Differenzierung nach einem Einflussparameter
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(Dix_)Katheter
|
11.773
|
5.798
|
9.514
|
22.545
|
4.139
|
30.683
|
0,67
|
|
(Dix_)Shunt
|
12.398
|
5.936
|
10.079
|
23.425
|
4.048
|
30.997
|
0,68
|
|
(Dix_)Heparin
|
9.182
|
2.039
|
8.987
|
11.916
|
4.139
|
21.230
|
0,82
|
|
(Dix_)Citrat
|
13.961
|
6.417
|
10.951
|
23.777
|
4.934
|
30.997
|
0,69
|
|
Did
|
9.421
|
2.131
|
9.191
|
12.302
|
4.139
|
21.230
|
0,82
|
|
Die
|
18.186
|
6.862
|
21.595
|
25.005
|
4.630
|
34.858
|
0,73
|
4.3.2.1.1.4 Ohne Differenzierung nach Einflussparametern
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dix
|
12.092
|
5.803
|
9.850
|
22.859
|
4.139
|
30.997
|
0,68
|
4.3.2.1.2 Kontinuierliche Verfahren
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dce_Heparin
|
10.880
|
3.417
|
10.285
|
15.522
|
3.883
|
31.908
|
0,76
|
|
Dce_Citrat
|
11.116
|
3.426
|
10.524
|
15.736
|
4.037
|
32.487
|
0,76
|
|
Dce
|
11.044
|
3.426
|
10.455
|
15.703
|
4.037
|
31.908
|
0,76
|
4.3.2.2 Ärztlicher Dienst
4.3.2.2.1 Intermittierende Verfahren
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AidX
|
2.072
|
582
|
1.964
|
2.835
|
1.102
|
8.653
|
0,78
|
|
AieX
|
2.518
|
540
|
2.427
|
3.231
|
1.469
|
5.181
|
0,82
|
|
AixX
|
2.208
|
604
|
2.124
|
3.007
|
1.134
|
6.630
|
0,79
|
4.3.2.2.2 Kontinuierliche Verfahren
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AceX
|
4400
|
1041
|
4217
|
5806
|
2620
|
10047
|
0,81
|
4.3.2.3 Intensivpflege bei kontinuierlichen Verfahren
|
Output
|
Mittelwert in s
|
Standardabweichung in s
|
Median in s
|
90. Perzentil in s
|
Minimum in s
|
Maximum in s
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ice_Heparin
|
5.799
|
1.183
|
5.753
|
7.315
|
2.248
|
12.567
|
0,83
|
|
Ice_Citrat
|
6.156
|
1.217
|
6.107
|
7.730
|
2.357
|
12.567
|
0,83
|
|
Ice
|
6.050
|
1.217
|
6.005
|
7.626
|
2.320
|
12.567
|
0,83
|
4.3.3 Verfahrenskosten
4.3.3.1 Vorbemerkung
4.3.3.2 Intermittierende Verfahren
4.3.3.2.1 Differenzierung nach drei Einflussparametern
|
Output
|
Mittelwert in €
|
Standardabweichung in €
|
Median in €
|
90. Perzentil in €
|
Minimum in €
|
Maximum in €
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GK_id_Katheter_Heparin
|
169,02
|
22,65
|
166,74
|
199,30
|
113,43
|
291,63
|
0,88
|
|
GK_id_Katheter_Citrat
|
196,43
|
22,54
|
194,23
|
226,23
|
138,93
|
314,19
|
0,90
|
|
GK_id_Shunt_Heparin
|
173,58
|
22,98
|
171,39
|
204,16
|
109,84
|
310,87
|
0,88
|
|
GK_id_Shunt_Citrat
|
200,99
|
22,87
|
198,85
|
231,38
|
135,47
|
333,43
|
0,90
|
|
GK_ie_Katheter_Heparin
|
180,22
|
20,80
|
177,97
|
208,08
|
125,57
|
297,69
|
0,90
|
|
GK_ie_Katheter_Citrat
|
330,65
|
20,61
|
328,40
|
358,21
|
278,67
|
444,41
|
0,94
|
|
GK_ie_Shunt_Heparin
|
188,85
|
20,70
|
186,58
|
216,24
|
134,16
|
295,47
|
0,90
|
|
GK_ie_Shunt_Citrat
|
339,28
|
20,51
|
336,94
|
366,70
|
285,88
|
442,17
|
0,94
|
4.3.3.2.2 Differenzierung nach zwei Einflussparametern
|
Output
|
Mittelwert in €
|
Standardabweichung in €
|
Median in €
|
90. Perzentil in €
|
Minimum in €
|
Maximum in €
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GK_id_Katheter
|
181,19
|
26,17
|
179,48
|
215,93
|
113,43
|
303,60
|
0,87
|
|
GK_id_Shunt
|
185,75
|
26,45
|
183,99
|
220,41
|
109,84
|
313,53
|
0,88
|
|
GK_ie_Katheter
|
273,37
|
69,35
|
303,77
|
345,14
|
129,39
|
424,51
|
0,80
|
|
GK_ie_Shunt
|
282,00
|
69,27
|
312,54
|
353,74
|
140,42
|
425,61
|
0,80
|
|
GK_id_Heparin
|
172,00
|
22,97
|
169,88
|
202,52
|
114,69
|
310,90
|
0,88
|
|
GK_id_Citrat
|
199,40
|
22,84
|
197,21
|
229,47
|
140,49
|
333,46
|
0,90
|
|
GK_ie_Heparin
|
183,11
|
21,21
|
181,05
|
211,52
|
128,70
|
296,66
|
0,90
|
|
GK_ie_Citrat
|
333,54
|
21,02
|
331,41
|
361,83
|
281,32
|
444,38
|
0,94
|
|
GK_ix_Katheter_Heparin
|
172,33
|
22,76
|
170,74
|
202,00
|
113,43
|
278,10
|
0,88
|
|
GK_ix_Katheter_Citrat
|
237,63
|
65,85
|
207,91
|
337,58
|
138,93
|
425,05
|
0,78
|
|
GK_ix_Shunt_Heparin
|
178,24
|
23,38
|
176,82
|
208,70
|
109,84
|
286,21
|
0,88
|
|
GK_ix_Shunt_Citrat
|
243,54
|
67,68
|
212,89
|
346,24
|
135,47
|
432,44
|
0,78
|
4.3.3.2.3 Differenzierung nach einem Einflussparameter
|
Output
|
Mittelwert in €
|
Standardabweichung in €
|
Median in €
|
90. Perzentil in €
|
Minimum in €
|
Maximum in €
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GK_ix_Katheter
|
209,21
|
64,83
|
185,73
|
328,23
|
113,43
|
410,94
|
0,76
|
|
GK_ix_Shunt
|
215,12
|
66,12
|
191,43
|
336,60
|
109,84
|
425,61
|
0,76
|
|
GK_ix_Heparin
|
175,34
|
22,99
|
173,86
|
205,45
|
114,69
|
286,21
|
0,88
|
|
GK_ix_Citrat
|
240,65
|
65,85
|
211,35
|
340,31
|
140,49
|
426,38
|
0,79
|
|
GK_id
|
182,65
|
26,73
|
180,94
|
217,95
|
116,44
|
333,43
|
0,87
|
|
GK_ie
|
279,82
|
75,12
|
317,15
|
354,40
|
130,92
|
444,41
|
0,79
|
4.3.3.2.4 Ohne Differenzierung nach Einflussparametern
|
Output
|
Mittelwert in €
|
Standardabweichung in €
|
Median in €
|
90. Perzentil in €
|
Minimum in €
|
Maximum in €
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GK_ix
|
212,23
|
64,85
|
188,80
|
330,98
|
116,44
|
425,61
|
0,77
|
4.3.3.3 Kontinuierliche Verfahren
|
Output
|
Mittelwert in €
|
Standardabweichung in €
|
Median in €
|
90. Perzentil in €
|
Minimum in €
|
Maximum in €
|
Homogenitätskoeffizient
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GK_ce_Heparin
|
486,53
|
40,05
|
481,96
|
540,43
|
384,79
|
711,21
|
0,92
|
|
GK_ce_Citrat
|
866,31
|
40,16
|
861,52
|
920,15
|
763,627
|
1100,76
|
0,96
|
|
GK_ce
|
751,22
|
179,25
|
840,89
|
909,03
|
384,79
|
1064,26
|
0,81
|