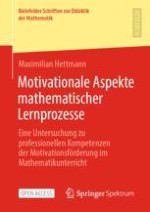6.1 Studiendesign Rahmen
6.2 Beschreibung der Intervention
Blockseminar in der Kontrollgruppe | Blockseminar in der Experimentalgruppe |
|---|---|
Einführung in die individuelle Förderung (vgl. vom Hofe 2011) | Einführung in die individuelle Förderung (vgl. vom Hofe 2011) und Selbstwirksamkeitsförderung (vgl. Bandura 1997) |
Grundvorstellungen (vgl. vom Hofe 1995) | Qualitative Diagnostik und Grundvorstellungen (vgl. vom Hofe 1995); (vgl. Wartha und vom Hofe 2005) |
Quantitative Diagnostik (vgl. z. B. Hafner 2008) | Quantitative Diagnostik (vgl. z. B. Hafner 2008) |
Erstellen eines Übersichtsplans für eine Förderung am Fallbeispiel | Erstellen eines Förderplans aus Diagnosematerialien für das Fallbeispiel Mia & Michael und Entwicklung von Nahzielen (vgl. Schwarzer und Jerusalem 2002) am Fallbeispiel Mia & Michael |
– Blütenaufgaben (vgl. Salle et al. 2014) – Selbst- und Partnerdiagnose (vgl. Reiff 2006) | Werkzeugkoffer der individuellen Förderung (vgl. Hettmann & Nahrgang et al. 2019) |
Erstellen eines Förderplans und einer Unterrichtsstunde am anderen Fallbeispiel (vgl. vom Hofe 2011; Hafner 2008). | Planen einer Förderstunde für das Fallbeispiel Mia und Michael (vgl. vom Hofe 2011; Hettmann & Nahrgang et al. 2019). |
Zusätzliche Inhalte: – Dokumentation und Reflexion von Lernerfolgen (vgl. Hettmann & Nahrgang et al. 2019) – Nutzen von Erwartungseffekten (vgl. Lorenz 2018) – Attributionales Feedback (vgl. Brandt 2014) |